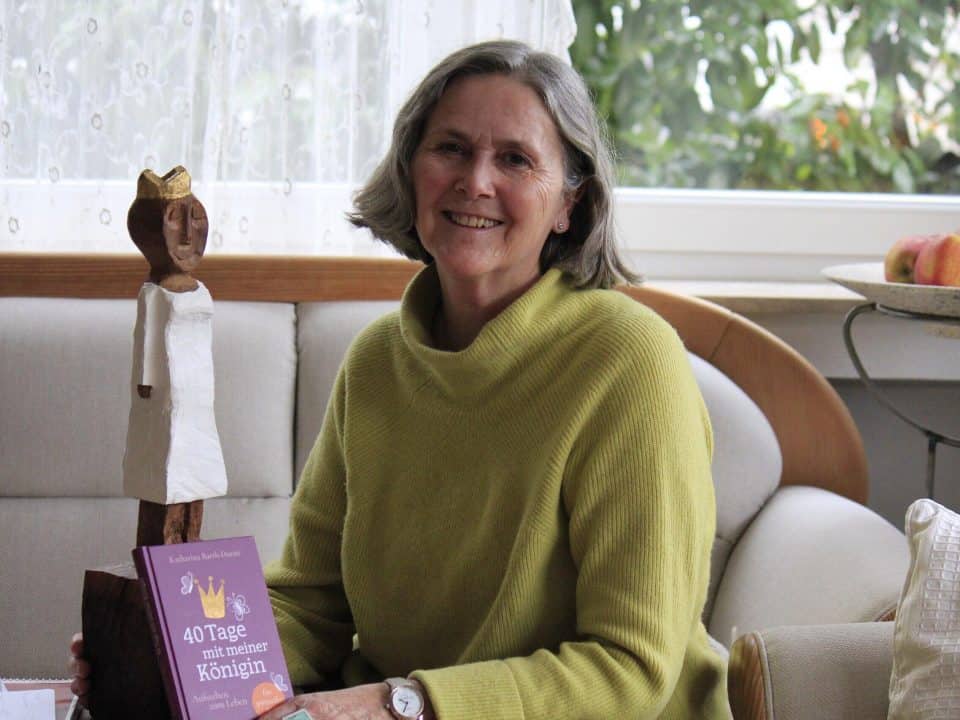Eigentlich waren und sind es zwei Prinzipien, welche die Theologie (der Befreiung) als „gefährlich“ erscheinen ließen: sie überwindet den frommen „Himmel“ individueller Innerlichkeit, und sie erachtet die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Gestaltung der Welt als eine genuin religiöse Aufgabe. Das erste Prinzip hat Konflikte mit einer traditionellen Theologie und Kirchenauffassung, das zweite mit dem Kapitalismus und dessen Steigbügelhaltern nach sich gezogen.
Fälschlicherweise meint man oft, es sei die Befreiungstheologie selber, die befreit. Es ist aber die göttliche Botschaft vom „Leben in Fülle“, die durch die Menschen befreiend in den jeweiligen Kontexten (wie in einem Gefängnis) Raum bekommt. Bis hin zum Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) galten die Kirchen und theologischen Fakultäten des „Südens“ (der so genannten Dritten Welt) als Befehlsempfänger und brave Musterschüler der im „entwickelten Norden“ (oder „Ersten Welt“) ausgedachten Neuerungen und Standards. Seien es scholastische, liberale oder historisch-kritische Ansätze, sie alle wurden von den meistens in Rom oder München promovierten Theologen Indiens, Nigerias oder Chiles diskussionslos geschluckt, wenn auch nicht immer gleichermassen verdaut.
Die Entdeckung der „Ortskirchen“ bedeutete zugleich das Aufwachen der so genannten „Jungen Kirchen“ des „Südens“ aus ihrem „dogmatischen Schlaf“; mit der zweiten Gesamtkonferenz des lateinamerikanischen Episkopats in Medellín im Jahre 1968 erfolgte die Entdeckung der so genannten „Dritten Welt“ als theologisches Subjekt. Statt weiterhin eifersüchtig nach Europa und Nordamerika zu schielen, entwickeln Theologinnen und Theologen eigene Methoden, analysieren ihren eigenen Kontext als „theologischen Ort“ und legen einen theologischen Entwurf vor, der im Alten Kontinent Irritation oder gar heiligen Zorn weckt. Die weitere Entwicklung der mit dem Etikett „Befreiungstheologie“ versehenen Reflexion und Praxis lässt sich auf zwei Schienen weiter verfolgen: Zum einen die thematische und kontextuelle Differenzierung des „klassischen“ Ansatzes, und zum anderen die „Globalisierung“ der Befreiungstheologie, weit über den lateinamerikanischen Kontinent hinaus.
Subjekte und Kontexte
War in der „klassischen“ Theologie der Befreiung (ca. 1965-1985) vom „Volk“ als Subjekt und theologischem Ort die Rede und galten die Sozialwissenschaften als die privilegierten Hilfsdisziplinen, so ändert sich dies paradoxerweise zeitgleich mit dem weltweiten Anschwellen der neoliberalen Welle (ab ca. 1985) und mit dem Fall der Berliner Mauer. Das eine politisch und wirtschaftlich gefasste Subjekt („Volk“) erhält weitere Merkmale wie Geschlecht, Hautfarbe, Kultur und Sprache. Die „Armen“ als privilegierte Subjekte des Heilshandelns Gottes werden historisch und kontextuell als Frauen, indigene Völker, Schwarze, Gefangene, kulturelle und sexuelle Minderheiten ausgemacht. Die Befreiungstheologie wird im Plural buchstabiert: es entstehen eine Reihe von unterschiedlichen „Befreiungstheologien“.
Es entstand zum Beispiel eine feministischen Befreiungstheologie, weil die Frauen und Mädchen nicht nur in Lateinamerika, sondern weltweit nach wie vor zu den ausgeschlossenen, diskriminierten und an den Rand gedrängten Menschen gehören. Es entstand aber auch eine indigene Theologie (in Lateinamerika „teología india“ oder „indianische Theologie“ genannt), weil die ursprünglichen Völker von Abya Yala (so die einheimische Bezeichnung für „Lateinamerika“) zu den vergessenen und verachteten Gruppierungen gehören. Es entstanden auch befreiungstheologische Ansätze aus den Perspektiven von Ökologie und Homosexualität, und nicht zuletzt eine afroamerikanische Theologie der schwarzen Minderheiten. In den USA entwickelte sich eine Latino-Theologie, welche die Situation der Hispanics (EinwanderInnen aus Lateinamerika) theologisch zu reflektieren begann.
Josef Esthermann