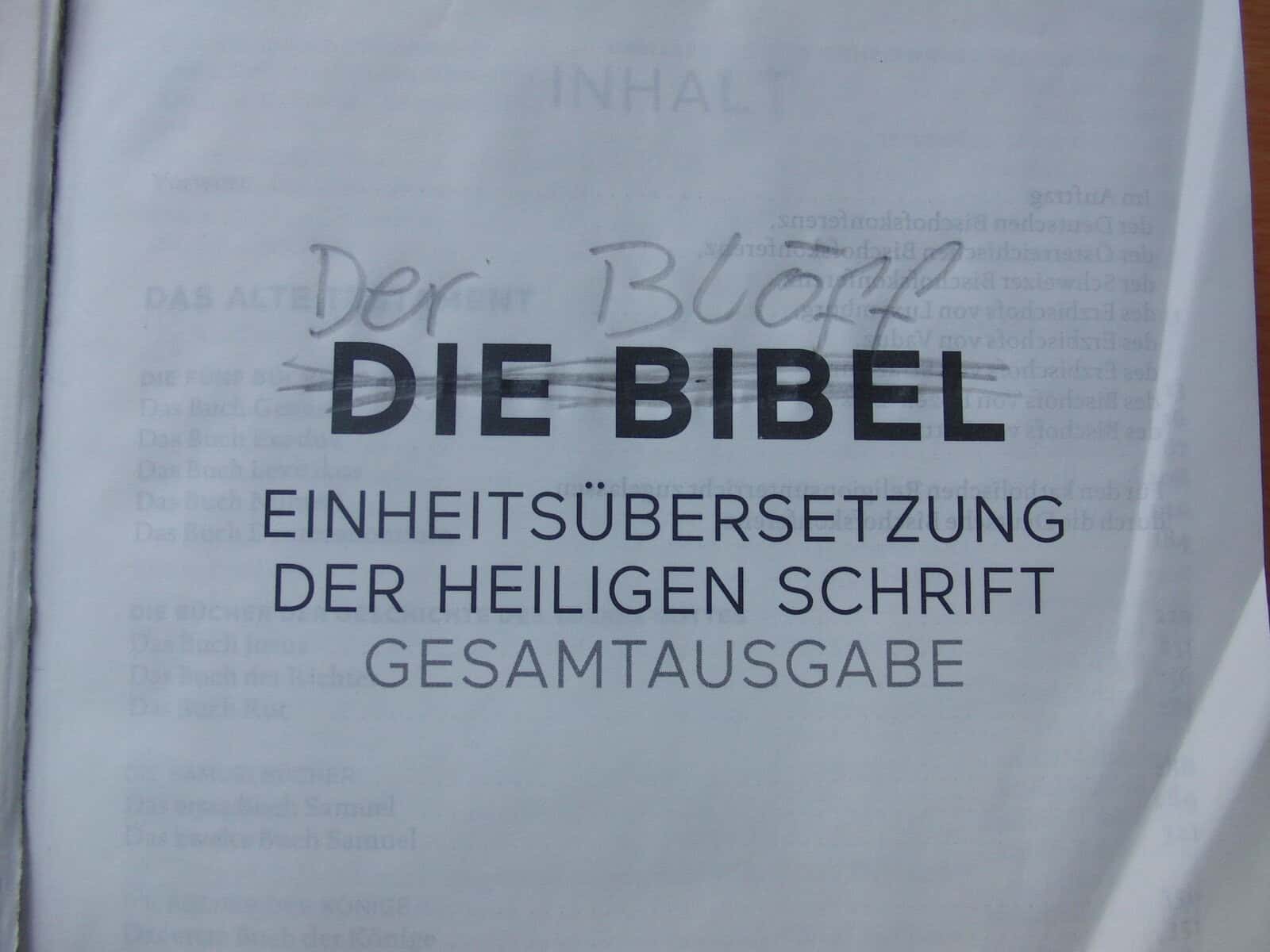Der Familienbund hat eine Handreichung mit dem Titel „Seid Menschen! Gemeinsam gegen Hass und Hetze“ veröffentlicht. Die Publikation ruft dazu auf, Haltung zu zeigen. Man wolle ein deutliches Zeichen gegen menschenverachtende Parolen, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit setzen, teilte der Verband in Paderborn mit.
Die Handreichung greift den Appell „Seid Menschen!“ der verstorbenen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (1921-2025) auf und verbindet theologische Grundlagen mit gesellschaftspolitischen Analysen sowie konkreten Handlungsvorschlägen. Die Publikation behandelt die theologische Grundlegung der Menschenwürde, Fragen von Solidarität und Demokratie sowie praktische Tipps für Zivilcourage im Alltag.
Stress-Gespräche mit PopulistInnen
Darum lohnt sich die Vorbereitung und die Übung. Und manchmal sollte man diese Gespräche bewusst vermeiden. Manchmal sind es gar nicht die RassistInnen, um die es gehen sollte, und immer braucht Überzeugung Zeit und mehrfache Irritationen. Der Ansatz, klug auf menschenverachtende und populistische Parolen zu reagieren und sensibel auf den Kontext, in dem die Aussage fällt, achten. Es sollten die Beziehungen und Umstände einbezogen, um eine passende Antwort zu dieser Aussage in diesem Kontext gefunden werden. Obendrein wird die Rolle der reagierenden Person in der Situation reflektiert, sogar ob jemand eher mit der Faust auf den Tisch haut oder jemandem Harmonie am Herzen liegt. Eine erste Hilfe, souverän zu bleiben, ist es, sich ein Ziel zu setzen. In jeder Situation lassen sich völlig unterschiedliche Ziele setzen: „schnell zurück zum Unterricht“, „das anwesende Opfer schützen“, „der Angreifenden Gelegenheit zum Nachdenken zu geben“, „diese Aussage nicht unwidersprochen im Raum belassen“ und dutzende Ziele mehr. Wer sich – auch in überraschenden Konfrontationen! – einen Atemzug Zeit nimmt, um sich ein passendes Ziel zu setzen, kann klarer und zielgenauer Reaktionsweisen auswählen. […]
Vier Zugänge
Ein erster Zugang ruft etwas Bekanntes in Erinnerung: Wer etwas im Gespräch mit Menschen erreichen möchte, begegnet ihnen wertschätzend. Wertschätzung bleibt die Grundhaltung, um etwas in Menschen anstoßen oder auch irritieren zu können. Dabei ist Wertschätzung gerade dann besonders schwierig durchzuhalten, wenn krasse Parolen gefallen sind. In einer Fortbildung lässt sich üben, bei welchen Sprüchen bestimmte Formen der Wertschätzung angemessen sind und Türen öffnen. Und wann es einer lauten, zumindest vehementen Konfrontation bedarf. Höflich im Ton, nicht herablassend, aber klar in der Sache kann diese gelebte Haltung Sympathien schaffen. Sie ist fast immer die Voraussetzung, dass jemand überhaupt zuhört. Am Ende dieses Kapitels erfolgt der Verweis darauf, dass der Umgang mit überzeugten RechtsextremistIinnen und geschulten ParteifunktionärInnen ein komplett anderer sein muss.
Ein zweiter Zugang setzt bei der persönlichen Betroffenheit an. Gerade hinter auffallend aggressiven und hochemotionalen Aussagen stecken mitunter eigene negative Erfahrungen. Steigt man nur auf die „Spitze des Eisbergs“ ein, die krasse Aussage, dann schrauben sich die Emotionen und die Lautstärke des Gesprächs immer weiter hoch. Wagt man es, die Parole für einen Moment zu ignorieren und nach der dahinter liegenden Erfahrung zu fragen, kann oft die Quelle für die Emotionalität gefunden werden. Und für die konkrete Erfahrung kann man so gut wie immer ehrlich beipflichten, dass das „nicht in Ordnung“ war. Dieses Beipflichten muss jedoch echt sein! In Konfliktgesprächen sind die Antennen für Falschheit und Floskeln ausgesprochen sensibel. Und erst wenn authentisch Verständnis für die konkrete Erfahrung gezeigt wird und jemand sich darin verstanden fühlt, kann die abstrakte Ableitung, die unzulässige Pauschalisierung zurückgenommen werden.
Ein dritter Zugang rechnet bisweilen mit Unbedarften, die menschenverachtende Parolen von sich geben und sich der historischen Dimension, der Bedeutung der Worte oder der darin liegenden Menschenverachtung gar nicht voll bewusst sind. Darunter fallen regelmäßig Jugendliche, die andere „beschimpfen“ mit unpassenden Bezeichnungen wie „behindert“, „schwul“, „Jude“. Vielen hilft diese Kategorie, ruhiger zu bleiben, wenn es naheliegend ist, dass auch Unbedarftheit eine Mitursache sein kann. Die Aussage muss dennoch zurückgewiesen werden, aber dafür sind sanftere, aufklärende Reaktionsweisen denkbar.
Ein vierter Zugang rechnet, gerade bei pubertierenden Jugendlichen oder rebellischen Erwachsenen auch mit der Möglichkeit, dass es Provokationen um der Provokation willen gibt. Provokateure verfolgen in der Regel ganz andere, heimliche Interessen: jemanden aus der Fassung bringen, Aufmerksamkeit für sich oder sogar Geschäftsinteressen. Die Reaktion besteht hier klugerweise darin, anders als erhofft zu reagieren oder das heimliche Interesse für alle Umstehenden offenkundig anzusprechen. Wer auf andere reagiert, tut gut daran, ein wenig über dessen Werte und Ideale zu wissen und entsprechend seine Argumente zu wählen: Bei materiell denkenden ZeitgenossInnen kann gegebenenfalls ein funktionalistisches Argument überzeugen („Wir brauchen Zuwanderung, um dem Fachkräftemangel zu begegnen und zur Absicherung unserer Solidarsysteme!“), bei mitfühlenden ZeitgenossInnen kann getrost auf die christliche Nächstenliebe verwiesen werden.
Dr. Andreas Fisch
Fachbereichsleiter an der Kommende Dortmund
 Weil es um den Menschen geht
Weil es um den Menschen geht
Hassparolen dürfen nicht den Ton bestimmen. Mit der Handreichung fordern die AutorInnen dazu auf, Haltung zu zeigen. „Es braucht Menschen, die nicht schweigen, wenn Hass laut wird“, erklärte Diözesangeschäftsführer Daniel Friedenburg. „Es reicht nicht, Hass und Hetze zu beklagen – wir müssen ihnen gemeinsam entgegentreten. Diese Publikation will dazu befähigen und ermutigen.“ Der Paderborner Weihbischof Josef Holtkotte betont im Vorwort: „Wer fragt, warum die Kirche sich äußert – hier ist die Antwort: Weil es um den Menschen geht. Und weil Menschsein in einer Kultur der Verachtung nicht gesichert ist.“ Erarbeitet wurde die Handreichung in Kooperation mit der Kommende Dortmund, der Theologischen Fakultät Paderborn und dem Institut für christliche Organisationskultur.