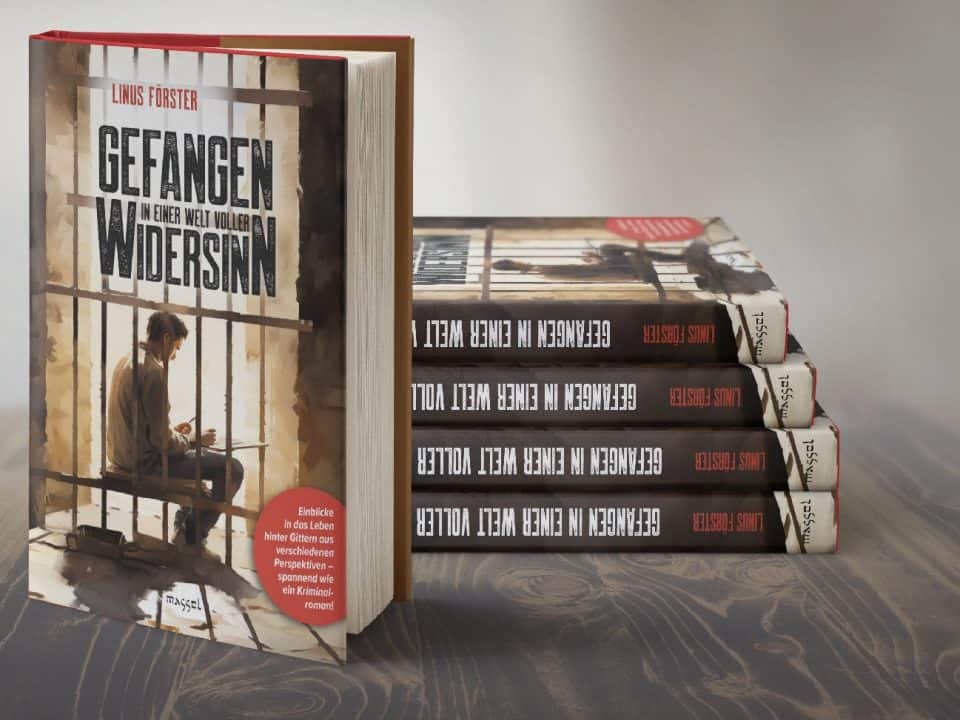Beim Blick auf die Weltlage kann einem angst und bange werden. Konflikte spitzen sich zu, gewaltige Auseinandersetzungen sind an der Tagesordnung. Manche Machthaber erweisen sich als regelrechte Verbrecher und eiskalte Mörder. Immer mehr werden die Grundsätze des Völkerrechts ignoriert und Menschenrechte mit Füßen getreten. Statt konstruktive Lösungen zu suchen, wird Misstrauen geschürt, die Wahrheit verdreht und Irrsinn propagiert. Auch in unserer Gesellschaft folgt man eher Stimmungen als Argumenten, verbreiten sich Hass und Hetze, ist eine zunehmende Verrohung festzustellen.
Verlockung, selbst wie Gott zu sein
Nach wie vor sind Menschen vor Versuchungen nicht gefeit und daher verführ- und manipulierbar. Das hat sich während der Hitler-Diktatur und zu DDR-Zeiten gezeigt und trifft erschreckenderweise auch heute wieder zu. Nimmt man den Entwurf der AfD in Sachsen-Anhalt für ein mögliches Regierungsprogramm nach der Landtagswahl ernst, wäre es hier mit der freiheitlichen Demokratie und dem Pluralismus, der Religionsfreiheit, wie wir sie kennen, und der Toleranz vorbei, müssten wir uns wieder auf autoritäre Verhältnisse einstellen und neu lernen, was es für uns als Christen und Christinnen heißt, zusammen mit vielen anderen als Feinde betrachtet und diskriminiert zu werden. Was bis vor kurzem undenkbar erschien, ist inzwischen zu einer möglichen Bedrohung geworden. Vom Menschen heißt es da im Buch Genesis, dass er von Gott als ein lebendiges Wesen geschaffen sei, hineingesetzt in eine Welt, die ihm ausreichend Nahrung bietet, und dazu berufen, sie in Gemeinschaft verantwortungsbewusst mitzugestalten. Zugleich kommt aber auch zur Sprache, dass Menschen Versuchungen erliegen können und damit ihr Schicksal aufs Spiel setzen. In der Erzählung vom Sündenfall im Garten Eden ist es die Verlockung, selbst wie Gott sein zu wollen, die dazu führt, Verbotenes zu tun. Darauf nimmt auch Paulus im Brief an die Römer Bezug, um dann aber darauf hinzuweisen, dass durch Jesus Christus die vom rechten Weg abgekommenen Menschen gnadenhaft wieder mit Gott versöhnt werden können. Und im Evangelium wird geschildert, wie der nach vierzigtägigem Fasten ausgehungerte Jesus den Versuchungen des Teufels widersteht: weder Steine in Brot verwandelt noch Gott durch eine riskante Aktion auf die Probe stellt, und auch nicht auf das Angebot von Macht und Reichtum eingeht.

Keine passende Antwort
Auch wenn die Heilige Schrift die „höchste Richtschnur“ für Christinnen und Christen ist, findet sich in ihr doch nicht gleich für jede moderne Herausforderung eine passende Antwort. Denken wir nur an solche komplexen und komplizierten Themen wie Krieg und Frieden, medizinethische Entscheidungsfindungen oder den Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Biblische Texte wollen und können uns aber grundsätzlich helfen, Irrwege zu meiden und das Leben gottgefällig und menschenfreundlich zu gestalten. Dazu müssen sie jedoch immer wieder im Kontext ihrer und unserer Zeit ausgelegt und gedeutet werden. Ein wichtiges und noch immer aktuelles Beispiel dafür sind die Prinzipien der katholischen Soziallehre. Ihr Ausgangspunkt liegt in den drängenden sozialen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Das Elend der Arbeiter erforderte eine Hilfe, die über die bisherige Fürsorge hinausging. Almosen waren da nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Man erkannte, dass es Ungerechtigkeiten gibt, die nicht privat verursacht sind, sondern in gesellschaftlichen Verhältnissen und Strukturen ihren Grund haben. Von da an hat unsere Kirche aus dem christlichen Glauben heraus „in kritischer Zeitgenossenschaft immer wieder strukturelle Missachtungen der Menschenwürde angeprangert, Verletzungen der Freiheit angeklagt und Gerechtigkeit für alle Menschen eingefordert“.
Katholische Soziallehre
So kam es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch zur Auseinandersetzung mit den totalitären Ideologien des Faschismus, des Nationalsozialismus und des Kommunismus. Im 20. und 21. Jahrhundert folgten solche Themen wie Frieden und Armut oder Globalisierung. Kritisch begleitet wurden diese Entwicklungen durch verschiedene lehramtliche Schreiben von Päpsten, durch das II. Vatikanische Konzil und mehrere Synoden, durch die wissenschaftliche Reflexion und die soziale Bewegung von engagierten Gläubigen. Dabei bildete sich eine katholische Soziallehre heraus, die für das Denken und Handeln nicht nur von Christinnen und Christen ausschlaggebend wurde. Auch unser Grundgesetz, die Europäische Menschenrechts-Konvention und andere Verträge sind davon geprägt. Worin bestehen aber nun die grundsätzlichen Aussagen der katholischen Soziallehre?
Da ist zunächst das Prinzip der Personalität. Damit wird deutlich gemacht, dass sich eine gerechte Gesellschaft nur dann bauen lässt, wenn jeder Mensch als Ebenbild Gottes die ihm gebührende Achtung genießt. Die Entfaltung der einzelnen Person steht an oberster Stelle. Als einzigartiges, unwiederholbares Wesen, als ein „Ich“, darf der Mensch deshalb nicht als bloßes Mittel zur Durchsetzung wirtschaftlicher, sozialer oder politischer Zwecke benutzt werden, als Arbeitssklave, Stimmvieh oder Kanonenfutter. Er hat einen Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben in freier Selbstbestimmung. Danach muss „der Mensch der Träger, Schöpfer und das Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen sein“. Die Gesellschaft ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Gesellschaft; mit anderen Worten auch: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Mit dem Prinzip der Solidarität wird dann die Überzeugung ausgedrückt, dass der Mensch von Natur aus nicht nur ein Individuum ist, sondern auch ein soziales Wesen, auf Austausch angelegt. Ohne die Hilfe anderer könnte kaum jemand leben. Solidarisch zu sein besagt, dass jeder Einzelne für das Wohl der Gemeinschaft mitverantwortlich ist. Umgekehrt trägt auch die Gesellschaft Verantwortung gegenüber ihren einzelnen Mitgliedern, vor allem gegenüber denen, die von sich aus keine Chance haben, sich selbst helfen zu können.
Für Würde eintreten
Dazu ergänzt das Prinzip der Subsidiarität die Einsicht, dass die gemeinsame Verantwortung nicht ausschließt, sondern sogar fordert, dass zunächst jedem Einzelnen und jeder Gruppe vorrangig die Pflicht und das Recht zukommen, ihre eigenen Angelegenheiten selbständig zu regeln. Staatliche beziehungsweise soziale Hilfe muss darum in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe sein. Subsidiarität betrifft die Verantwortlichkeit der “Zivilgesellschaft“ mündiger Bürgerinnen und Bürger und soll die Einzelnen, vor allem die Familien, aber auch die Kommunen sowie die Vereine, Verbände und anderen Gruppierungen vor Vereinnahmung und Entmündigung durch übergeordnete Institutionen schützen. Was man selbst tun kann und soll, darf einem der Staat nicht einfach abnehmen. Im Prinzip des Gemeinwohls drückt sich schließlich die Überzeugung aus, dass es über alle menschlichen Konflikte und Gegensätze hinweg gemeinsame Werte und Ziele gibt, die Achtung und Berücksichtigung beanspruchen und häufig sogar Vorrang vor Einzelinteressen haben. Gesellschaftliches Zusammenwirken wird hierbei nicht als „Null-Summen-Spiel“ angesehen, bei dem der eine nur das gewinnen kann, was der andere verliert, sondern bringt für alle Vorteile, wenn auch in verschiedenem Umfang. Man könnte auch sagen: „Gemeinnutz geht vor Eigennutz.“
Die vierzig Tage der österlichen Bußzeit sind eine gute Gelegenheit, für uns selbst, unsere Mitmenschen und unser gesellschaftliches Zusammenleben noch sensibler zu werden. Besinnen wir uns auf unsere christlichen Werte. Widersetzen wir uns jeglichem Extremismus und Populismus, allen nationalistischen und fremdenfeindlichen Tendenzen. Treten wir auch weiterhin entschieden für die unveräußerliche Würde eines jeden Menschen ein, für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, Solidarität und Nächstenliebe, ein tolerantes und friedliches Miteinander. Dabei – so meine ich – können die Prinzipien der katholischen Soziallehre als hilfreiche Orientierung dienen. Möge das Bewusstsein dafür tiefer in uns wachsen – für unser eigenes Leben und für ein menschenfreundliches Miteinander.
Gerhard Feige | Brief des Bischofs von Magdeburg zur österlichen Bußzeit 2026
Genesis 2, 7-9; 3,1-7 / Römer 5, 12. 17-19 / Matthäus 4, 1-11