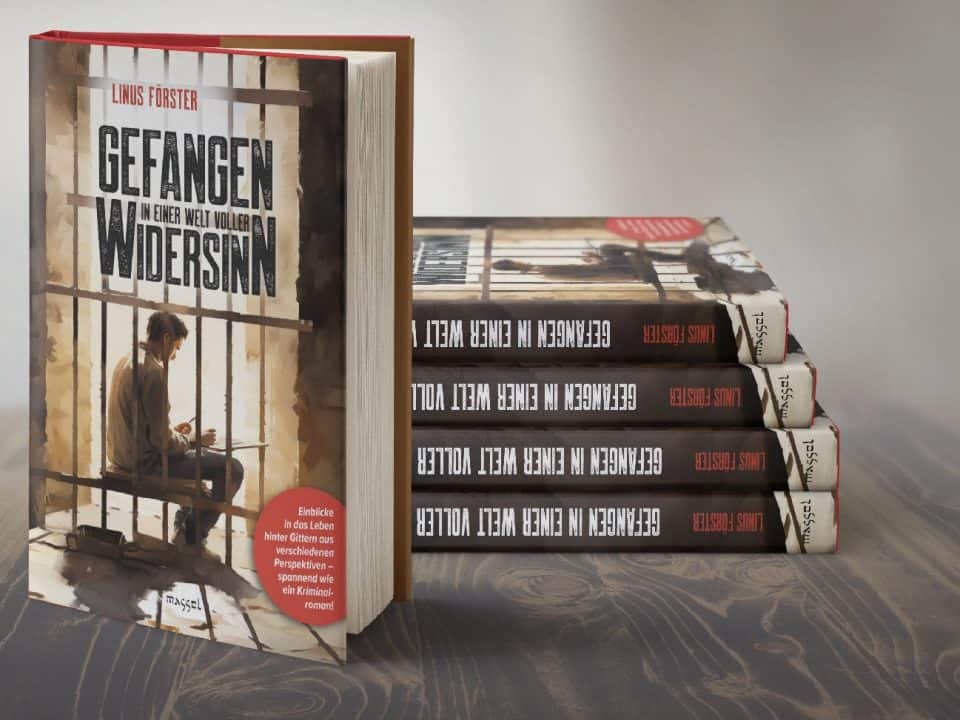Es ist die Suche nach der Mitte, die in der Corona-Zeit verloren gegangen ist. Die Mitte, für die die deutschen Konservativen stehen oder zumindest stehen wollen und das an der Seite der Kirchen. Diese Selbstverständlichkeiten der alten Bonner und der frühen Berliner Republik gelten spätestens seit Corona nicht mehr. Wo ist die Mitte jetzt? Vielleicht an diesem Tag im Juni im Basecamp in Berlin im Bezirk Mitte. Hier werden keine radikalen Positionen gegen die Corona-Maßnahmen vertreten, diese aber auch nicht als alternativlos verteidigt. Die folgende Rezension des Autors Helge Buttkereit ist beim Magazin multipolar erschienen.

Thomas A. Seidel und Sebastian Kleinschmidt (Hrsg.): Angst, Glaube, Zivilcourage. Folgerungen aus der Corona-Krise, R. Brockhaus, 288 Seiten, 25 Euro
Der lange Weg zu dieser Diskussion begann bei einer Tagung der Evangelischen Bruderschaft St. Georgs-Orden (StGO) und des Bonhoeffer-Haus e.V. im Jahr 2022. Dessen Tagungsband „Angst, Politik, Zivilcourage“ erschien im Juli 2023 und wurde vier Monate später „depubliziert“ – ein modernes Wort für Selbstzensur des zuständigen Verlags. Verantwortlich war die Evangelische Verlagsanstalt, die dem Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) und der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands gehört. Eine geänderte Neuauflage gab es nicht, so wurde ein neuer Verlag gefunden und neue Autoren angesprochen. Neben den Diskutanten – nur Laschet hat keinen Beitrag beigesteuert – haben unter anderen die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, der Publizist Alexander Kissler, der Virologe Andreas Radbruch, die Juristin Frauke Rostalski und der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, Texte beigesteuert.
Prüft alles und das Gute behaltet
Das neue Buch „Angst, Glaube, Zivilcourage“ soll beim Brückenbauen helfen. Und beim Suchen nach der Mitte. Dass das nicht so einfach ist, zeigt die Vorgeschichte, die gleich an dieser Stelle noch einmal ins Gedächtnis gerufen werden soll. Danach geht es um die Inhalte des Buches und die Podiumsdiskussion, bei der Armin Laschet interessante Einblicke ins Regierungshandeln im März 2020 gab und sich auch offen für eine politische Aufarbeitung zeigte – selbst einem Untersuchungsausschuss war er nicht abgeneigt. Das scheint auch ganz im Sinne von Thomas A. Seidel. Er war früher Direktor der Evangelischen Akademie in Thüringen, dann Beauftragter der Kirchen bei Landtag und Landesregierung und Reformationsbeauftragter Thüringens.
Er hat das aktuelle wie auch das „depublizierte“ Buch gemeinsam mit dem Publizisten Sebastian Kleinschmidt herausgegeben. Die Leitwörter „Angst, Glaube, Zivilcourage“ haben, so heißt es im Vorwort, zu einer multiperspektivischen Betrachtung geführt. „Wir möchten, dass sie als Anstoß und Ermutigung zu weiterer Aufklärung verstanden wird.“ Als Theologen stellen die Herausgeber dem Ganzen einen Satz des Apostels Paulus voran: „Prüft aber alles und das Gute behaltet“ (1. Brief des Paulus an die Thessalonicher, 5,21). Sie wollen dabei, so sagte es Seidel zu Beginn der Podiumsdiskussion, die Menschen guten Willens erreichen. Menschen, die bereit seien abzuwägen, Argumente sprechen zu lassen, „auch in den Streit zu gehen, auch in einen heftigen Streit zu gehen, aber dabei die Würde und Achtung des anderen nicht aus dem Blick zu verlieren“. Man könnte das die klassische Mitte nennen, nachdem die Vertreter der Mitte spätestens in der Corona-Zeit zu Extremisten der Alternativlosigkeit geworden waren, denen die Maßnahmen-Kritiker unversöhnlich gegenüber standen.
Rückblick: Das „depublizierte“ Buch
Am 10. November 2023 verkündete das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik: Das Buch „Angst, Politik, Zivilcourage“ werde umgehend aus dem Verkauf genommen. Es gebe Passagen in dem Buch, „die keinen Zweifel lassen, dass sie weder mit den publizistischen Standards der evangelischen Publizistik vereinbar, noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind“. Es geht insbesondere um eine Aussage, die als antisemitisch gedeutet wurde. Inakzeptabel sei „die offene Propagierung von mehreren als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Medien sowie von antisemitischen Verschwörungsportalen als ‚Gegenöffentlichkeit‘ zu den im Text als angeblich korrupt und fremdgesteuerten Medien“. Man müsse aus Fehlern lernen und dieses Buch sei ein gravierender Fehler.
Das Buch war damals schon etwa vier Monate auf dem Markt, hatte sich gut verkauft. Es war zuvor nach dem Erscheinen mit einer Podiumsdiskussion unter Beteiligung des Landesbischofs der Kirche Mitteldeutschlands, Friedrich Kramer, im Erfurter Rathaus beworben worden. Die Diskussion war kontrovers und erregte auch überregional einige Aufmerksamkeit, insbesondere nachdem Philine Conrad ihren Eröffnungsbeitrag in der Berliner Zeitung veröffentlicht hatte. Conrad ging es darum, wieder in den Austausch zu kommen. Nach der Diskussion gab es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob diese selbst einen guten Beitrag dazu leisten konnte. Aber es wurde diskutiert und das Buch in der Folge durchaus positiv rezensiert. Die Wortmeldungen vor und nach der „Depublikation“ können auf der Website des StGO nachvollzogen werden.
Hier ist es vor allem wichtig, auf die entscheidende Rezension einzugehen, die Ende Oktober 2023 erschien und auf die sich auch die zitierte Pressemitteilung bezog. Denn der Text auf der Website des Magazins Zeitzeichen handelte davon, dass das Buch „nicht salonfähig“ sei. Demokratiefeindliche Positionen hätten den bürgerlichen Mainstream erreicht. Zwei Theologen kritisieren das Buch und den St. Georgs Orden für eine Nähe zur „Neuen Rechten“ oder zur Partei „Die Basis“. Die Rezensenten zeigen sich aufgeschlossen für eine sachliche Aufarbeitung, sehen aber zu sehr Polarisierung im Band. Es werde „grundsätzlich zum Schlag gegen die liberale und offene Gesellschaft“ ausgeholt. Insbesondere Heimo Schwilks Beitrag wird kritisiert, hier finden sich die Empfehlungen für (rechte) Medien und Verlage, hier ist die als antisemitisch kritisierte Passage zu finden. Der Autor selbst hat dies nach eigener Aussage so nicht gemeint und bedauerte später das Missverständnis.
„Antipolitik richtet sich nie gegen die Politik schlechthin, sondern immer gegen unerwünschte oder bedrohliche Ausprägungen einer ganz bestimmten, konkreten Politik. Vor allem richtet sie sich gegen ein Zuviel an Politik, gegen anmaßende Politik. Oder anders: Sie baut Dämme gegen die Flut politischer Zumutungen. Sie weist Politik in ihre Schranken.“ Das in Zusammenhang mit der Kritik an den Corona-Maßnahmen war wohl (neben den anderen Kritikpunkten) für die Rezensenten zu viel. Ein weiterer Autor des Bandes, der Theologie-Professor Rochus Leonhardt, reagierte kurz nach der Zeitzeichen-Rezension mit einem offenen Brief und einer Einladung zur Diskussion auf die Kritik. In seinem Text wirft er Fragen auf, die für eine Aufarbeitung wichtig seien und die Autoren der Kritik seiner Ansicht nach übergangen haben, indem sie vor allem mit Schlagworten argumentierten. Leonhards Text war nicht der letzte, Rezensenten des Buches kritisierten das Vorgehen des Verlags, Theologen und Wissenschaftler ebenfalls. Der Verlag fand sich indes nicht zu einer – veränderten – neuen Auflage bereit. Von einer Mitte waren die Beteiligten zumindest zu dieser Zeit noch weit entfernt, das Buch schien eher die Gräben vertieft zu haben. Zumal neben der Maßnahmen-Kritik dezidiert konservative Positionen vertreten wurden. Allerdings: Die von Leonhardt angeregte Diskussion fand im Oktober vergangenen Jahres tatsächlich statt. Bei der Tagung „Das wird man doch noch sagen dürfen – oder? Diskurskultur und Demokratie“, gab es nach Erinnerung von Leonhardt einen friedlichen und freundlichen Austausch von Argumenten.
Ein neuer Versuch
Im Juni 2025 ist das neue Buch erschienen, das im Titel die Politik durch den Glauben ersetzte. Inhaltlich hat sich viel mehr geändert. Gerade einmal sechs Autoren des „depublizierten“ Buches sind wieder mit dabei. Die Perspektive der Corona-Aufarbeitung weitet sich. Christine Lieberknecht schreibt in ihrem Geleitwort von der Freiheit eines Christenmenschen und vom „,Mut zur Freiheit‘, weil ‚uns Christus befreit‘ hat“. Christen dürften sich nicht verrückt machen lassen und in der Freiheit „klar und selbstbewusst“ leben. Der christliche Zugang, hier von der Pastorin und ehemaligen Ministerpräsidentin Thüringens formuliert, ist einer von mehreren im Buch. Alexander Kissler greift im zweiten Geleitwort auf Hannah Arendt und Karl Jaspers zurück. Der Sinn von Politik sei Freiheit, haben beide sinngemäß geschrieben. „Der freie Mensch fühlt sich selbst nur frei, wenn auch die anderen frei sind“, zitiert Kissler Jaspers. Auch wenn das ein womöglich utopisches Ziel sei, mit Blick auf die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen der Corona-Zeit habe die Exekutive „das Zepter der Macht auf demokratiegefährdende Weise gehandhabt“.
Sowohl Kissler als auch Lieberknecht zitieren den früheren Abtprimas der Benediktiner, den im vergangenen Jahr verstorbenen Mönch Notker Wolf und dessen Buch „Warum lassen wir uns verrückt machen?“ (Bonifatius Verlag, 2022) Wolf schreibt darin vom „Klima der Angst“, von der bewussten „Verängstigung der Bevölkerung“ und sucht nach Wegen für die Sorglosen, der Angst zu entkommen. Wolfs Buch ist zu empfehlen und zwar durchaus auch als Sommerlektüre. Wolf liefert eine theologische (in diesem Fall katholische) Sicht auf die Gegenwart, in der der Satz „es könnte ja was passieren“ ängstliche Urstände feiert. Noch ein Satz von Wolf: „Das Seltsame ist aber: Je sicherer alles wird, desto unsicherer fühlt sich der Mensch, desto bedrohlicher scheint ihm die Welt.“ Der kleine Exkurs zu Notker Wolfs Buch hat einen weiteren Grund. Nicht nur die beiden Geleitworte entlehnen ihm wichtige Überlegungen zu Angst, sondern auch Herausgeber Thomas A. Seidel. Und die Reaktion des Bonifatius Verlags, die Seidel mit Bezug auf eine Anfrage zitiert, weist wiederum auf die fehlenden Corona-Aufarbeitung hin. Denn der Verlag hat offenbar weiterhin Angst, in die falsche Gesellschaft zu geraten. Was gerade angesichts der Worte Wolfs von einer gewissen Ironie zeugt. Seidel hätte gerne Ausschnitte aus dem Buch in „Angst, Glaube, Zivilcourage“ veröffentlicht, der Bonifatius-Verlag lehnte das ab. Schon bei der Veröffentlichung hatte der Verlag es offenbar sorgsam vermieden, den Begriff Corona irgendwo im Titel oder im Klappentext vorkommen zu lassen.
Zwischen Glaube und Politik
Die Beiträge des Buches bewegen sich zwischen Glaube und Politik, zwischen der Suche nach den Gründen für die Angst und den Möglichkeiten, ihr persönlich und mit Zivilcourage zu widerstehen. Es geht im ersten Teil um verschiedene Formen der Angst in Theologie, Gesellschaft und Politik. Die MDR-Journalistin Christiane Cichy schreibt über die Recherchen zu den Corona-Impfschäden, wobei sie einige Opfer zu Wort kommen lässt. Im zweiten Teil liefern die Autoren Überlegungen dazu, wie „Wege aus der Gefahr“ gefunden werden können, die von Kristina Schröders Überlegungen zur Anmaßung der Politik bis zu Erich Freislebens Überlegungen zu einem Begriff von Aufklärung reichen, „welcher die Globalisierung auf intellektueller und materieller Ebene um eine geistig-seelische erweitert“. Es brauche einen offenen und fairen Diskurs um eine Versöhnung aller religiösen und ideologischen Differenzen. Der dritte Teil enthält Überlegungen von Medizinern, Juristen und Theologen zu einer konsequenten Aufarbeitung. Frauke Rostalski fragt, ob „wir uns nicht (endlich) mehr Luft geben [sollten] im Denken und Sprechen“ und endlich das getan werden sollte, was längst überfällig ist: „uns den Dämonen der Vergangenheit stellen und fragen, was richtig, was falsch war, um gemeinsam einen Fahrplan für die Zukunft zu entwickeln“. Gemeinsam die Polarisierung überwinden, dieses Ziel eint die meisten Beiträge des Buches.
 Im Buch sind unterschiedliche Sichtweisen vertreten, sodass die Beiträge bei der Lektüre schon das Nachdenken und Abwägen anregen können. Da ist Kristina Schröder, die nach eigenen Worten als Innenpolitikerin der CDU für einen starken Staat gefochten hat und jetzt von „offenkundigen Exzessen des Autoritären“ schreibt, wobei sie keine Verbindung zwischen beidem ziehen kann oder will. Als Konservative will sie abwägen und sieht eine „Erosion unseres Verantwortungsbegriffes“. Wer bei den drastischen Vorgaben freiwillig noch eine Schippe drauflegte, galt als verantwortungsbewusst, übernahm aber nach Schröders Überzeugung keine Verantwortung. Angst und Sicherheit, da wären sie wieder. Eine wesentlich schärfere Position als Schröder vertritt beispielsweise der bereits erwähnte Rochus Leonhardt. Er kritisiert das Obrigkeit-Untertan-Verhältnis zwischen Arzt und Patient, das der Staat durch die Impfkampagne installiert habe. Und die Kirche habe da nicht nur mitgemacht, sie habe „Impffrömmigkeit“ befördert, wenn sie das Impfen zur Nächstenliebe erklärte, und es damit in einer „staatsfrommen Untertanenmentalität“ religiös überhöhte. Aus dieser Überformung des Glaubens wie des braven Staatsbürgers wieder in Richtung Mitte zu gelangen, fällt sichtbar schwer – zumal angesichts neuer Zeitenwenden. Da bleibt schließlich zunächst einmal das Recht und die Klarstellung des ehemaligen Verfassungsrichters Hans-Jürgen Papier, dass „im freiheitlichen Rechtsstaat des Grundgesetzes auch bei epidemischen Notlagen und ähnlichen Krisensituationen keinesfalls der Satz gelten [kann], der – gute – Zweck heilige alle Mittel oder die Not kenne kein Gebot.“ Wenn es keine roten Linien mehr gibt, sei das mit der Verfassungsrechtslage unvereinbar.
Im Buch sind unterschiedliche Sichtweisen vertreten, sodass die Beiträge bei der Lektüre schon das Nachdenken und Abwägen anregen können. Da ist Kristina Schröder, die nach eigenen Worten als Innenpolitikerin der CDU für einen starken Staat gefochten hat und jetzt von „offenkundigen Exzessen des Autoritären“ schreibt, wobei sie keine Verbindung zwischen beidem ziehen kann oder will. Als Konservative will sie abwägen und sieht eine „Erosion unseres Verantwortungsbegriffes“. Wer bei den drastischen Vorgaben freiwillig noch eine Schippe drauflegte, galt als verantwortungsbewusst, übernahm aber nach Schröders Überzeugung keine Verantwortung. Angst und Sicherheit, da wären sie wieder. Eine wesentlich schärfere Position als Schröder vertritt beispielsweise der bereits erwähnte Rochus Leonhardt. Er kritisiert das Obrigkeit-Untertan-Verhältnis zwischen Arzt und Patient, das der Staat durch die Impfkampagne installiert habe. Und die Kirche habe da nicht nur mitgemacht, sie habe „Impffrömmigkeit“ befördert, wenn sie das Impfen zur Nächstenliebe erklärte, und es damit in einer „staatsfrommen Untertanenmentalität“ religiös überhöhte. Aus dieser Überformung des Glaubens wie des braven Staatsbürgers wieder in Richtung Mitte zu gelangen, fällt sichtbar schwer – zumal angesichts neuer Zeitenwenden. Da bleibt schließlich zunächst einmal das Recht und die Klarstellung des ehemaligen Verfassungsrichters Hans-Jürgen Papier, dass „im freiheitlichen Rechtsstaat des Grundgesetzes auch bei epidemischen Notlagen und ähnlichen Krisensituationen keinesfalls der Satz gelten [kann], der – gute – Zweck heilige alle Mittel oder die Not kenne kein Gebot.“ Wenn es keine roten Linien mehr gibt, sei das mit der Verfassungsrechtslage unvereinbar.
Interessant sind ebenfalls die Beiträge von Medizinern, die für eine Aufarbeitung plädieren. Detlev H. Krüger und Klaus Stöhr kritisieren Kollegen, die von „wissenschaftlichen Sprechmandaten“ für die Öffentlichkeit fabulieren und kritisieren die Diskursverweigerung im neuen WHO-Pandemieabkommen. Andreas Radbruch wiederum klärt noch einmal über die Immunologie auf und hofft auf den Abbau der zunehmenden Impfskepsis, die durch unsachliche Polemik gegen Ungeimpfte befeuert worden sei. Wenn er sich gleichzeitig für Impfungen ausspricht (gegen humane Papillomaviren, Masern, Polio und gegen das Epstein-Barr-Virus), wird er sicher bei vielen Maßnahmenkritikern auf Widerspruch stoßen. Aber letztlich ist das die Chance eines Buches, das größtenteils auf der Suche nach der verlorenen Mitte ist: Es kann zum Nachdenken ebenso wie zum Widerspruch anregen und dadurch das notwendige Gespräch und die Aufarbeitung befördern.
Laschet schaut zurück
Gesprochen wurde Mitte Juni 2025 in Berlin. Es ist ein besonderes Podium: Der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, sitzt inmitten von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Laschet (CDU) diskutiert mit der ehemaligen Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU), mit dem Virologen Detlef H. Krüger, dem Lungenfacharzt Thomas Voßhaar und der Theologin Dorothea Wendenbourg. Zusammengebracht haben die Diskutanten der christliche R. Brockhaus Verlag und der evangelische Pfarrer im Ruhestand Thomas A. Seidel. Das Ziel: Aufarbeitung, Dialog und Verständigung. Anders als bei der Diskussion vor zwei Jahren in Erfurt ist in den 75 Minuten auf dem Podium Einigkeit zu spüren. Armin Laschet geht offen damit um, dass er damals zu den Entscheidern gehörte. Heute scheint er bereit zu sein, die Fehler von damals zu reflektieren. Selbst einen Untersuchungsausschuss könne er sich vorstellen. „Das darf dann auch nicht zur Rechthaberei werden, sondern man muss sich selbstkritisch hinterfragen: Wie sind die Mechanismen, die wir in Zukunft, wenn so etwas noch mal passiert, nutzen.“ Und Laschet bietet Einblick in die Entscheidungsfindung. Er erinnert sich an die reguläre Ministerpräsidentenkonferenz am 12. März 2020, in der die Regierungschefs der Länder zunächst unter sich waren. Die Leitung hatte in dieser Zeit Markus Söder als bayerischer Ministerpräsident und dieser habe gesagt, er werde am nächsten Tag die Schulen schließen. So weit seien die anderen noch nicht gewesen, sagt Laschet.
Aber wenn er [Markus Söder] das macht, gerät man natürlich unter einen Druck, dass man das auch macht. Weil sonst die Leute in Nordrhein-Westfalen fragen, wieso werden die Bayern geschützt und wir nicht?
Das war ohnehin die ganze Zeit, diese Reiberei, wo man den Eindruck erweckt, es gibt das sich selbst ernannte Team Vorsicht. Und die anderen sind eigentlich die Leichtfertigen, das Team Leichtsinn.
Armin Laschet
Ehemaliger Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen
Dann kam an diesem Tag das Gespräch mit der Bundeskanzlerin, dann kam Alexander Kekulé und kündigte die Schulschließung in Halle/Saale an, dann kam Christian Drosten, der sagte, er sei bisher gegen Schulschließungen und sei jetzt dafür. „Und damit nahm die Dynamik ihren Lauf und die ersten erklärten, wir machen es morgen und am Ende haben es wir alle dann gemacht“, so Laschet. Gruppenzwang im Kanzleramt. Laschet bekennt, dass er nicht gewusst habe, was das richtige war. Er kritisiert in der Diskussion die Medien und den Mainstream. 90 bis 95 Prozent der Medien hätten sich als Unterstützer des Staates verstanden, hätten nie mal kritisch nachgefragt. Und auch die Kirche – und ihre Medien, zu denken wäre an einen ebenfalls „depublizierten“ Text zur Impfung – fühlte sich auf der moralisch richtigen Seite. Laschet hingegen meldet mindestens heute Zweifel an und bittet gleichzeitig um Verständnis. Die Bilder von Bergamo, die Kritik an denen, die in angeblicher Verantwortungslosigkeit mehr öffnen wollten als die anderen. Und er erklärt, dass die Kollegen Ministerpräsidenten auch aus eigener Angst handelten. Die, die Kinder haben, hätten anders geredet als andere, so Laschet. Die Angst, so war es auf dem Podium Konsens, habe über die Rationalität gesiegt. Sowohl Politiker als auch Journalisten und andere Akteure hätten sich von der Angst leiten lassen. Was mehr als fünf Jahre nach dem Papier des Bundesinnenministeriums keine neue Erkenntnis ist. Herausgeber Thomas Seidel erinnerte vor diesem Hintergrund an „die zentrale Botschaft der Bibel: ‚Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es kann dir nichts passieren.‘“ Diese Botschaft habe er nicht vernommen, auch nicht in seiner Kirche.
Wo ist die Mitte?
Das die Buch und Podiumsdiskussion haben noch nicht sehr viel Resonanz ausgelöst, schon gar nicht im medialen Mainstream. Ein ehemaliger Ministerpräsident, der über die Corona-Zeit spricht, interessiert dieser Tage nur wenige Journalisten. Ein Artikel im evangelischen Magazin Idea, einer in der Wochenzeitung Freitag. Beide schauten auf Buch und Podiumsdiskussion. Dazu immerhin erste Rezensionen in der Welt und in der Kirchenzeitung Mitteldeutschlands. Die Analyse der freien Journalistin Katharina Körting ist durchaus eine Erwähnung wert zumal mit Blick auf die Frage nach der Mitte. Auch Körting erzählt die Geschichte des „depublizierten“ Buches und der Diskussion darüber ebenso wie die Hintergründe zum aktuellen Band sowie der Podiumsdiskussion. Und sie schaut voraus, beispielsweise auf eine Diskussion im Rahmen der „#Verständigungsorte“ von Kirche und Diakonie, wobei im August in Coswig in Dresden über Corona gesprochen werden soll. Körting schreibt am Ende ihres Beitrags: „Anscheinend muss sich neben Politik-, Medien- und Kultur- auch der Kirchenbetrieb fragen (lassen), warum er Coronamaßnahmenkritik lange fast einhellig als ‚rechts‘ labelte, damit bis heute den Rechten überlässt – und was er damit anrichtet.“ Jakob Hayner nimmt sich nach der Lektüre des Buches vor allem die Kirchen und ihren Umgang mit Corona vor. Das Buch sprühe teilweise „vor dem protestantischen Pathos der Selbstverantwortung in Freiheit zu Gott“, schreibt er. Hayner möchte den Sammelband „auch als Symptom einer gestörten Beziehung der zwei Reiche Luthers deuten“. Die zwei Reiche bezeichnen, grob gesprochen, das weltliche und das geistliche Regiment. Was solle mit dem Reich Gottes passieren, fragt Hayner, wenn die weltliche Gewalt immer übergriffiger wird und das Leben selbst dem totalen Zugriff unterwirft? „Identifiziert man sich mit dem Aggressor oder widersteht man? Dieser Riss geht durch die Kirchen, und man wird die zerreißenden Kräfte in den aktuellen politischen Verhältnissen zu suchen haben.“ Für die Mitte wird es schwer.
Pastor Wichard von Heyden, dessen Beitrag am Ende des Buches dem ganzen Werk den Titel gegeben hat, hofft auf eine Aufarbeitung auch vonseiten der Kirche. Sein Text im Pfarrerblatt Anfang des Jahres hat zumindest unter den Berufskollegen hohe Wellen geschlagen, hat zu vielen Online-Kommentaren und Leserbriefen geführt. Corona polarisiert weiterhin auch in der Kirche. Von Heydens Beitrag aus dem hier besprochenen Buch erschien im Juni auch in etwas veränderter Form im Pfarrerblatt und die Redaktion erhofft sich eine Diskussion und eine Aufarbeitung. Von Heyden, der den Begriff des „Extremismus der Mitte“ nutzt meint: „Nach den vermeintlich alternativlosen Einschränkungen der Menschenwürde halten zunehmend mehr Menschen den Links- oder Rechtsextremismus für hinnehmbar oder relativ harmlos. Wer dem wehren will, muss aufarbeiten: nicht oberflächlich, sondern kritisch, unbequem und drängend.“ Ob wenigstens die (evangelische) Kirche die Mitte (wieder)findet?
Helge Buttkereit, geb. 1976, hat sein Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Journalistik mit einer Arbeit zu „Zensur und Öffentlichkeit in Leipzig 1806-1813“ abgeschlossen. Nach journalistischen Tätigkeiten bei verschiedenen Medien und Buchveröffentlichungen über die Neue Linke in Lateinamerika arbeitet der Autor in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Mit freundlicher Genehmigung: multipolar | Titelbild: imago