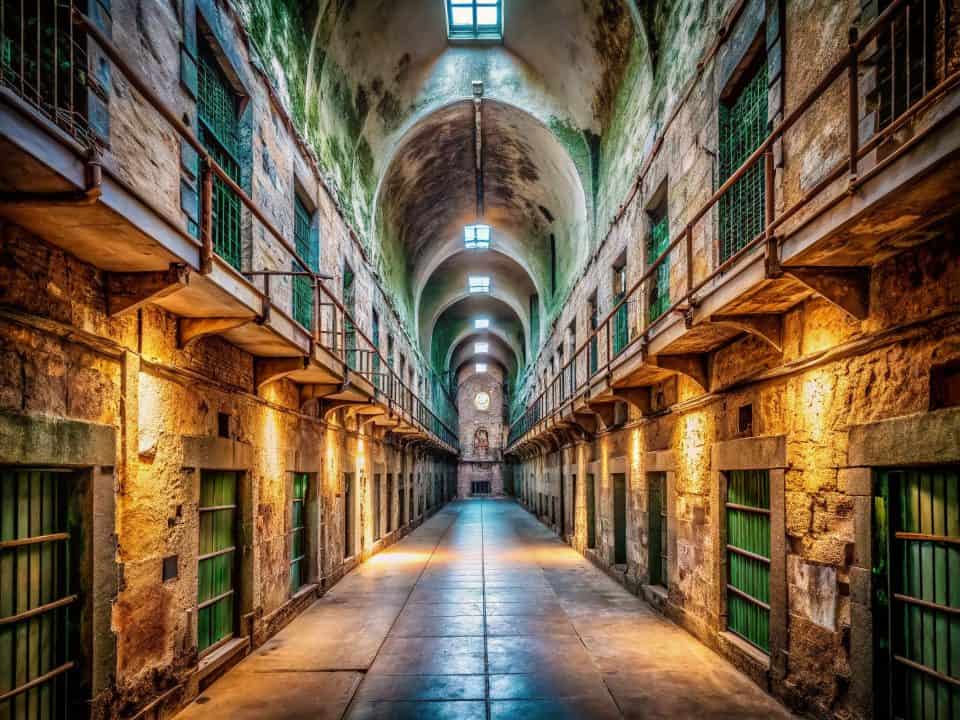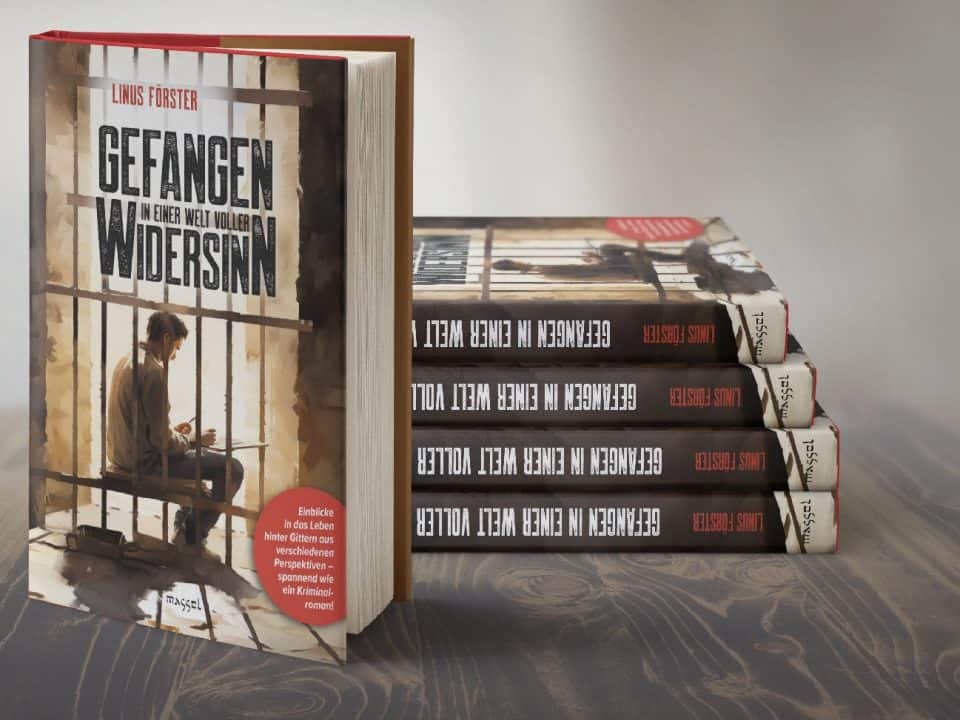Von der Tradition gibt es evangelische und katholische SeelsorgerInnen im Strafvollzug. Doch wie wird auf die zunehmende religiöse Pluralität und die muslimisch-religiöse Betreuung reagiert? Ausgehend von der Vorschrift zur christlichen Anstaltsseelsorge aus der Weimarer Reichsverfassung wird die aktuelle Praxis der 16 Bundesländer anhand der gesetzlichen Regelungen sowie der Vereinbarungen mit den Religionsgemeinschaften betrachtet.
Einer gewachsenen Kooperation mit den Kirchen steht ein zunehmender Bedarf gegenüber, religiöser Pluralität im Rahmen der Gefängnisseelsorge zu begegnen. Die Arbeit zeigt Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Ermöglichung einer religiös-pluralen Gefängnisseelsorge auf. Rebekka Gengenbachs Promotion beschäftigt sich mit den Herausforderungen der religiösen Pluralität im Kontext der Anstaltsseelsorge, insbesondere unter dem Blickwinkel des Religionsverfassungsrechts. Sie argumentiert, dass die zunehmende religiöse Diversifizierung der Gefängnispopulation und sich wandelnde gesellschaftliche Vorstellungen von Religionsausbildung die traditionellen Modelle der Anstaltsseelsorge vor neuen Herausforderungen stellen.

Dr. Rebekka Gengenbach: Religiöse Pluralität in der Anstaltsseelsorge, Verlag Nomos, 1. Auflage 2025, 281 Seiten. Das Werk ist Teil der Reihe Schriften zum Religionsrecht. 95 Euro
Kernaussagen
- Traditionelle Anstaltsseelsorge versus religiöse Pluralität: Die klassische Anstaltsseelsorge war historisch stark auf die christlichen Konfessionen ausgerichtet. Die zunehmende Präsenz von Gefangenen anderer Religionen (Islam, verschiedene freie religiöse Gemeinschaften etc.) erfordert eine Neuausrichtung, um allen Gefangenen eine gleichberechtigte Ausübung ihrer Religion zu ermöglichen.
- Religionsfreiheit im Strafvollzug: Gengenbach betont, dass die Religionsfreiheit auch im Strafvollzug gilt und dass die Anstaltsleitung verpflichtet ist, die Religionsausübung der Gefangenen zu gewährleisten. Dies beinhaltet nicht nur die Möglichkeit der Gottesdienste, sondern auch die Bereitstellung von religiösen Texten, Speisen, Kleidung und die Ermöglichung religiöser Praktiken.
- Abwägung zwischen Religionsfreiheit und Anstaltsordnung: Die Religionsausübung darf jedoch nicht die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährden. Gengenbach untersucht, wie eine angemessene Abwägung zwischen dem Schutz der Religionsfreiheit der Gefangenen und den Sicherheitsinteressen der Anstalt auszusehen hat. Sie kritisiert pauschale Verbote religiöser Praktiken, die keine Gefährdung darstellen. Ist eine gezielte Missionsarbeit evangelikaler Organisationen am unfreien Ort der JVA, beispielsweise die Muslime zu Christen bekehren wollen, möglich?
- Ein besonderer Fokus liegt auf den Herausforderungen, die von „neuen religiösen Bewegungen“ ausgehen. Gengenbach betont, dass diese nicht von vornherein als „problematisch“ eingestuft werden dürfen, sondern dass eine differenzierte Prüfung im Einzelfall erfolgen muss. Eine pauschale Untersagung der Religionsausübung – nur weil eine Gruppe einer Neureligiösen Bewegung – angehört, wäre verfassungswidrig.
- Rolle der Seelsorger: Die Seelsorger haben eine wichtige Rolle bei der Vermittlung zwischen den Gefangenen, der Anstaltsleitung und den Religionsgemeinschaften. Sie sollten die religiöse Vielfalt wertschätzen und sich für eine inklusive Seelsorge einsetzen. Gengenbach fordert, dass Seelsorger über interreligiöse Kompetenzen verfügen und in der Lage sind, mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Gefangenen umzugehen.
- Aktuelle rechtliche Entwicklungen: Die Autorin analysiert aktuelle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und anderer Gerichte zum Thema Religionsfreiheit im Strafvollzug und zeigt auf, wie diese die Praxis der Anstaltsseelsorge beeinflussen.
Fazit
Gengenbach kommt zu dem Schluss, dass die Anstaltsseelsorge vor großen Herausforderungen steht. Um diesen gerecht zu werden, bedarf es einer Neuausrichtung der Seelsorgearbeit, die die religiöse Vielfalt der Gefangenen anerkennt und respektiert. Dies erfordert eine differenzierte rechtliche Betrachtung, eine Verbesserung der interreligiösen Kompetenzen der Seelsorger und eine offene Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Die Autorin plädiert für eine proaktive und inklusive Anstaltsseelsorge, die einen wichtigen Beitrag zur Resozialisierung der Gefangenen leisten kann.