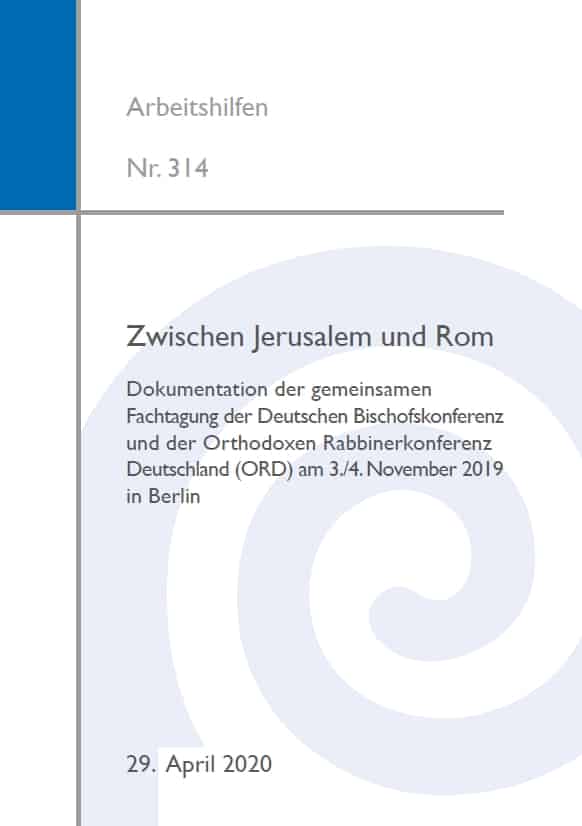Der Anschlag auf die Synagoge in Halle/Saale an Jom Kippur (Versöhnungsfest) am 9. Oktober 2019 hat in erschreckender Weise vor Augen geführt, wie fragil und zerbrechlich die politischen und zivilgesellschaftlichen Anstrengungen, im Land der Täter und im Land der Schoa, sind. Die Deutsche Bischofskonferenz und die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD) haben aus diesem Grund ihre Dokumentation der ersten gemeinsamen Fachtagung anfang November 2019 veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Tagung stand der 50. Jahrestag der Konzilserklärung zur Haltung der Kirche zu nichtchristlichen Religionen.
Es reicht nicht, nur auf politisches und zivilgesellschaftliches Engagement zu verweisen, sondern es muss der Kirche auch um die genuin theologische Aufarbeitung struktureller und institutionell gebundener antijüdischer Stereotypen und ihrer fortdauernden Wirkmacht in der kirchlichen Gegenwart von heute gehen. Am gemeinsamen Treffen nahmen 20 Rabbiner und 20 katholische Vertreter, Bischöfe, Theologieprofessoren und kirchliche Dialogbeauftragte, teil. „Um denen, die nicht an der Fachtagung teilnehmen konnten, einen Einblick in die Diskussionen zu geben, haben wir uns entschlossen, in der Dokumentation die Referate und Statements zu veröffentlichen“, schreiben im Vorwort Rabbiner Avichai Apel vom Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD) und Bischof Dr. Ulrich Neymeyr aus Erfurt, der die Unterkommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum leitet.
 Verfolgung wegen Andersartigkeit ausgesetzt
Verfolgung wegen Andersartigkeit ausgesetzt
Das orthodoxe Judentum ist eine Religion mit einem sehr ausgeprägten Religionsgesetz, die Halacha, an das es gebunden ist und das es nicht mittels Erlassen ändern kann. Daher müssen sich alle Erklärungen, die sich als Ausdruck des traditionellen, orthodoxen Judentums herausstellen, von Ideen distanzieren, die entweder durch das jüdische Gesetz oder ihre Philosophie verboten sind. Darüber hinaus kann das Judentum als ältester monotheistischer Glaube nicht einfach neue Theologien einbeziehen, insbesondere nicht solche Ideen, die die Ursache für die Spaltungen waren, die die Gründung späterer Glaubensgemeinschaften veranlassten.
Die besondere Art und Weise, wie das Christentum die Vereinbarkeit und Kontinuität zwischen dem Alten und Neuen Testament behauptet, funktioniert einfach nicht für die Beziehung des Judentums zur hebräischen Bibel, die sich deutlich von der Art unterscheidet, wie ein Katholik zum Beispiel den gleichen Text liest. Ebenso kann die Art und Weise, wie Muslime biblische Propheten interpretieren, um sie in Einklang mit der islamischen Theologie zu bringen, für einen Muslim wirken, aber nicht für einen Juden, der dieselben Personen anders sieht, nämlich durch die Linse seiner eigenen religiösen Tradition.
Es kann auch nicht geleugnet werden, dass das jüdische Volk, das während seiner Geschichte immer wieder erzwungene Bekehrungen erlebte, das Ziel intensiver Missionierungen durch Mehrheitsgläubige war und der Verfolgung und Ausgrenzung wegen seiner Andersartigkeit ausgesetzt war, als die Mehrheitsgesellschaften das Judentum und seine einzigartige Botschaft tilgen wollten. Die Hartnäckigkeit, mit der die Juden im Angesicht der Bedrohung durch Folter und Tod an dem Glauben ihrer Ahnen festhielten, zeugt von der tiefen Bedeutung, die Juden und Judentum immer der Treue zu den jüdischen Prinzipien zugeschrieben haben. […]
Rabbiner Arie Folger
 Räume des Diskurses und gemeinsamen Handelns
Räume des Diskurses und gemeinsamen Handelns
Der Titel der Arbeitshilfe nennt die beiden Städte Jerusalem und Rom. Sie stehen einerseits als Orte des bilateralen Austausches zwischen Vertretern des orthodoxen Judentums und der katholischen Kirche in den vergangenen Jahren, andererseits stehen Rom und Jerusalem auch für eine pars pro toto-Beziehung: Jerusalem für das Judentum, Rom für die katholische Kirche. Beide Städte sind immer wieder von unterschiedlichen Gruppen und zu unterschiedlichen
Zeiten als das Zentrum der eigenen Welt(sicht) konzipiert worden. Davon geht diese Erklärung aber weg und siedelt ihre Überlegungen weder in Jerusalem noch in Rom, sondern explizit dazwischen an – zwischen Jerusalem und Rom. Mit dieser Überschrift wird somit ein Raum eröffnet, der ein Spannungsfeld darstellt: Dieses sehr junge und neue Gespräch, das durch die Neuausrichtung der katholischen Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil möglich wurde, steht im Spannungsfeld zu der fast 2000-jährigen Geschichte voller Gewalt und Leid, bei der die katholische Kirche ihren Anteil hatte.
In wohltuender Klarheit benennt „Zwischen Jerusalem und Rom“ die Unterschiede zwischen Juden und Christen, die als „tiefgreifend“ und als „unüberbrückbare Trennung zum Judentum“ bezeichnet werden (S. 10). Diese markieren eine Grenze. „Die Unterschiede in der jeweiligen Lehre sind wesentlich und können nicht debattiert oder verhandelt werden“ (S. 11). Als solche Unterschiede werden u. a. das christliche Bekenntnis zu Jesus als dem Messias und Christus sowie die Lehre der Trinität identifiziert. Beide sind für das Christentum jedoch zentrale Theologumena.
Die Benennung von Grenzen im Dialog ist von unschätzbarem Wert sowohl für den Verständigungsprozess nach innen, in die eigene Gemeinschaft hinein, als auch gegenüber dem Anderen: Den Gesprächspartner in seiner eigenen Sprache zu verstehen und seinen Weg als eigenständigen Weg ohne Abwertungsrhetorik anzuerkennen, kann nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Mit der in der Erklärung vorgenommenen Grenzziehung korreliert das Aufzeigen von Räumen: Es sind sowohl Räume des getrennten Diskurses als auch Räume des gemeinsamen Handelns. […]
Barbara Schmitz