Als einer der zentralen kritisierten Aspekte der Kirche tritt zunehmend die Hierarchie als ihre Organisationsform in den Vordergrund, nicht nur als unzeitgemäß, sondern auch als nicht der Botschaft Jesu angemessen. Auch durch die Mißbrauchsskandale wird deutlich, wie diese Machtstruktur Räume öffnet, die mißbraucht werden und extremen Schaden anrichten können. Ein solches Handeln, das vorgeblich im Namen Jesu geschieht, widerspricht aber aber zutiefst diesem Namen und Jesu Auftrag.
1. Hierarchie in der Bibel und Geschichte
Die Erfahrung des Volkes Gottes, in der Bibel (sowohl Ihre Erfahrung in Ägypten, als auch in 1 Samuel 8) beschrieben, zeigt deutlich, dass die Organisationsform Hierarchie (damals als Monarchie) ursprünglich nicht von Gott gewollt war. Indem der Profet Samuel dem Volk Israel deutlichst die Nachteile dieser Organisationsform vor Augen führte, die sich im Laufe ihrer Entfaltung in der Geschichte auch bewahrheiteten, bemühte sich Samuel das Volk in dem Wunsch, sich der Organisationsform der sie umgebenden Völker anzupassen, umzustimmen. Das Volk Israel sollte nicht durch seine Größe und Pracht von Gott Zeugnis geben, sondern durch die Qualität ihres Zusammenlebens. So endete die Zeit der Monarchie/Hierarchie für Israel im Jahr 587 v.Ch. in einem totalen Zusammenbruch, in dem sie alles verloren und im Exil neu beginnen mußten. Als Kennzeichen des Volkes Gottes stach nun eine bewußt gelebte Spiritualität hervor, die sich im Buch Levitikus präsentiert. Sie soll ein Leben nach dem Willen Gottes ermöglichen. Nach der Erfahrung der Sklaverei in Ägypten war dem Volk der Wille Gottes klar geworden: Gott möchte, daß die Menschen in Freiheit leben und daß niemand über den anderen Macht ausüben soll. Mit der Hierarchie als Organisationsform verloren sie diese Freiheit und brachte sie erneut in Sklaverei, ins Exil nach Babylonien.
 Als Kaiser Konstantin im Jahr 313 dem Christentum Gleichberechtigung mit anderen Religionen gewährte, übernahm die Kirche langsam jene Hierarchie als die Organisationsform, die die römische Militärherrschaft kennzeichnet und groß gemacht hat. Heute müssen wir uns fragen: Ist das die Organisationsform, die auch Jesus im Evangelium angestrebt hat? So wie die Etikette auf der Verpackung den Inhalt ankündigt, so zeugt auch eine ersichtliche Struktur vom Inhalt ihrer Botschaft. Die Organisationsform sollte mit der Botschaft Jesu übereinstimmen! Das spüren und fordern viele Christen in unserer Zeit. Wie nach dem totalen Zusammenbruch Israels 587 v. Chr. mit einem tiefgreifenden Reformprogramm seine wahre Identität als Volk Gottes neu definiert hat, so kann Gott stets neu durch eine Krise sein Volk in einem Neuanfang zu seiner wahren Identität führen.
Als Kaiser Konstantin im Jahr 313 dem Christentum Gleichberechtigung mit anderen Religionen gewährte, übernahm die Kirche langsam jene Hierarchie als die Organisationsform, die die römische Militärherrschaft kennzeichnet und groß gemacht hat. Heute müssen wir uns fragen: Ist das die Organisationsform, die auch Jesus im Evangelium angestrebt hat? So wie die Etikette auf der Verpackung den Inhalt ankündigt, so zeugt auch eine ersichtliche Struktur vom Inhalt ihrer Botschaft. Die Organisationsform sollte mit der Botschaft Jesu übereinstimmen! Das spüren und fordern viele Christen in unserer Zeit. Wie nach dem totalen Zusammenbruch Israels 587 v. Chr. mit einem tiefgreifenden Reformprogramm seine wahre Identität als Volk Gottes neu definiert hat, so kann Gott stets neu durch eine Krise sein Volk in einem Neuanfang zu seiner wahren Identität führen.
Einen Ansatz zu einem Aufbruch sehe ich im 2. Vatikanischen Konzil, das die Kirche als “wanderndes Volk Gottes” definiert hat, weg von der vorherrschenden hierarchischen Sichtweise hin zu einer horizontalen, in der alle als Geschwister gleichen Wert und Gottesebenbildlichkeit besitzen. Mit Respekt vor der persönlichen Gotteserfahrung aller, auch der anderen Kulturen, kann sie ein ebenbürtiges Miteinander nach dem Willen Jesu gestalten. Rangordnung und Machtausübung über andere entspricht weder dem Willen Gottes im Alten Testament, noch der Jüngerschaft Jesu im Neuen. Ein Klassendenken widerspricht der Gemeinschaft mit Jesus und untereinander. Wir sollen Geschwister und Freunde sein, Volk Gottes auf dem Weg, wie es das 2. Vatikanischen Konzil sagt, nicht hierarchisch, sondern horizontal gegliedert. Darin gelten gleiche Rechte und Ansehen für alle. Besonders die Schwachen stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit, ohne Bevormundung, noch untergeordnet. Zu gegebener Zeit mag die monarchische Hierarchie eine effective Organisationsform gewesen sein, in der Bibel erwies sie sich als Irrweg. Heute ist sie in einer Krise. Keine Struktur sollte als absolut und unveränderbar gesehen werden. Jede Zeit sucht sich ihren Weg in ihren Herausforderungen, dabei darf es für die Kirche nie eine Form sein, die der Botschaft Jesu zuwiderläuft.
2. Definitionen von Hierarchie
“Hierarchie” stammt aus dem altgriechischen und bedeutet “heilige Ordnung/heiliger Ursprung”. Sie bezog sich zunächst lediglich auf die Religion. “Hierarchie ist die Rangordnung von Menschen, Tieren oder Sachen untereinander. Es handelt sich um ein System von Elementen, die einander über- bzw. untergeordnet sind. … Die Elemente dieser Ordnung sind in vertikaler Reihung nach Bedeutung für die Entscheidungsmacht, Kompetenzen und Rang positioniert.” (Google) Die Hierarchie zeigt sich als pyramidenförmige strenge Rangordnung. In einer Hierarchie hat jede Person ihre genau festgelegten Rechte, Befugnisse und Zuständigkeiten. Was ist das Heilige an dieser Ordnung? Ist es nur, weil sie das Volk Gottes betrifft? “Heilig” bleibt das Volk auch in einer anderen Organisationsstruktur. Welche Vor- und welche Nachteile hat diese Organisationsform? Kirche ist weder Monarchie, noch Demokratie, welche auch Gefahr läuft, sich zu einer Diktatur zu entwickeln, Parteien- oder Mehrheitsdiktatur, wie auch personengebunden an charismatische Führer, in der Kirche möglich durch einen Elitestand mit Anmaßung von Rechten und Macht, mit der sie sich anderen gegenüber durchsetzen. Jesus sagt zur Ausübung von Macht im Vergleicht zu der sie umgebenden Gesellschaft: Bei Euch aber soll es nicht so sein! (Lukas 22,24-26)
3. Kirchenbilder dienen der Entwicklung
Die Bibel, besonders im Neuen Testament, kennt verschiedene Kirchenbilder. Die Bilder sollen ihr Identität als Kirche in der jeweiligen Situation stärken (Beispiele: vorwiegend als Volk Gottes, dann Einzelbilder, wie: Schiffsgemeinschaft mit Jesus im Sturm der Zeit; Salz und Licht für die Welt; Netz mit Fischen aller Art; Jesus als Fundament und wir der Bau, zusammengehalten durch den Heiligen Geist; Leib Christi mit Jesus als Haupt und wir die Glieder; Tempel des Heiligen Geistes; Braut Christi; der Geist, der das messianische Werk Jesu weiterführt; Gemeinschaft in geschwisterlicher Liebe und Dienst, ein Herz und eines Geistes; Kirche als von Jesus ins gelobte Land geführte Gemeinschaft. Immer wieder und vorwiegend als Gemeinschaft und neues Gottesvolk unterwegs. In dieser Vielfalt stellte die Kirche immer stärker das Modell des Leibes Christi in den Vordergrund, in dem Christus das Haupt und wir seine Glieder sind. Im Laufe seiner Geschichte “be-Hauptete” sich eine Elite mit der Rolle, die ursprünglich Christus gebührt. An seiner Statt “regiert”, dirigiert und entscheidet sie, während der Körper dem Haupt gehorchen soll. Die in Kirchenkreisen gängige Bezeichnung “Amtskirche” (Kirchenhierarchie in Unterscheidung zum Volk Gottes) gibt Zeugnis davon. Sie lässt den Anschein erwecken, als ob im Alltag neben der Kirche als Volk Gottes noch eine andere fungiert, nach deren Entscheidungen sich das Volk richten sollte. Diese Amtskirche hat andere Funktionen, Entscheidungsbefugnisse und Machtausübung. Sie besetzt die Stelle des Hauptes, während die Laien (welch unpassender Name für ChristInnen) die ausführenden Glieder sind.
Entspricht diese Struktur der Botschaft und Mission Jesu? Welches Gottesbild spiegelt diese Struktur wieder? Gott, der über allem steht (fern und oft unverstanden), statt IHN in seinem Volk und in den Menschen zu erleben und seine Nähe zu spüren? Mir scheint dies entspricht nicht der Mission Jesu und einem Zusammenleben als Geschwister im Glauben. Welche Organisationsform entspricht mehr der Botschaft und dem Anliegen Jesu? Wir müssen eine Organisationsform leben, die mehr dem Anliegen Jesu entspricht, so wie z.B. das 2. Vatikanische Konzil es sieht: Kirche als Volk Gottes unterwegs, als Brüder und Schwestern. Nicht ohne Grund steht das kirchliche “Fussvolk” der Hierarchie kritisch entgegen, als mündiges Gottesvolk zu ihren eigenen persönlichen Gotteserfahrungen stehend. Es ist besonders in dieser Krisenzeit Not-wendig und der Zeitpunkt zum Korrigieren. Es geht dabei um die Botschaft Jesu und unser Gottesbild. Zu wenig fragt die Kirche sich, ob hinter dem wachsenden Priestermangel nicht Gott selber steht, der dieses Modell durch ein Neues, ihm mehr entsprechendes, ersetzen oder erweitern möchte, um so auf die Herausforderungen und dem Ruf der Zeit nach Gott entsprechend antworten zu können, denn er ist es doch, der beruft.
Die hierarschiche Ordnung steht in der Gefahr der Bevormundung und Reglamentierung der Untergeordneten und bewegt sich damit weg von geschwisterlichem Miteinander in Mitbestimmung und gemeinschaftlichem Gestalten. Die Kirche ist ein Schutzraum für alle, besonders für die Schwachen. Die Machtbefugnis und das Ansehen der im Rang Höherstehenden ist zu oft der menschlichen Versuchung erlegen, diese Macht zu nutzen für persönliche und auch dienstliche Wünsche, bis hin zum Missbrauch. Jesus ist gekommen, um uns und allen das Heil zu bringen. Ob die kirchlichen Aktiven wirklich dem Heil der Menschen dienen, können in erster Linie die Adressaten beurteilen, ob sie darin Heil erleben oder nicht. Mission ist, den Menschen, so wie Jesus es tat, Heil zu bringen. Kein Aufdrängen, sondern das Heil spürbar machen. So wird diese Botschaft gern als Geschenk angenommen und dann auch selber gelebt. “Ich bin gekommen damit sie das Leben haben und es in Fülle haben”, sagt Jesus (Joh 10,10). Die Kirchenleitung hätte in einem neuen Modell eher eine ordnende, verkündigende und orientierende Rolle für das Volk, die dem Gelingen des Lebens und der Mission Jesu dienen. Dazu zählt auch, alte und neue Glaubenserfahrungen zu bewahren und weiterzugeben, auch die der geistlichen Führung zur Erhaltung und beleben der Gottesbeziehungen der Gläubigen und dem Visualisieren von Gottes Wirken.
4. Kirchendefinition des 2. Vatikanischen Konzils
Von der Kirche als Hierarchie zur Kirche als Volk Gottes: Die Konzilstexte Lumen Gentium bezeichnet die Kirche als Mysterium, Volk Gottes, Sakrament des Heiles für alle Welt (LG 1-8, 13-16/17). Mission besteht darin, den Menschen Heil zu bringen, wie Jesus es getan hat. Gerade darin begreifen die Laien ihre Sendung in der Kirche. Dies gilt besonders in den “Dritte-Welt-Kirchen”. Dies tun die Laien nicht nur im Auftrag der kirchlichen Hierarchie, sondern als ihr Recht und Ihre Pflicht aufgrund ihrer Taufe und Sendung. (Anmerkungen aus meinen Notitzen zu den Vorlesungen von Prof. Kuhl zur Missionologie an der theologischen Fakultaet in Trier im Wintersemester 1981).
Umdenken von der Universalkirche zu den Ortskirchen: Laut Rahner/Ratzinger in “Episkopat und Primat”, 1963, existiert Kirche konkret immer in den Ortskirchen, und das eigentliche und letzte Prinzip der Einheit in der Kirche ist der Heilige Geist (bei aller Bedeutung des Papsttums). Daraus ergibt sich die Legitimität für Pluriformität und eigene Wege (Lumen Gentium 13 und 37-40). Junge Kirchen sind nicht mehr bloß Objekt, sondern Subjekt der Mission. Auch die Würzburger Synode erinnert 1975 daran, dass primär die jeweilige Ortskirche verantwortlich ist für ihren missionarischen Auftrag. Die Gesamtkirche vollzieht ihren universalen Auftrag immer nur durch die jeweiligen Ortskirchen (legitimer Pluralismus). “Die wahrhaft eingewurzelte Teilkirche, die sich verschmolzen hat mit den Menschen… Ihre Art zu beten, zu sehen, zu lieben… die Art Ihre Welt zu sehen… hat die Aufgabe, das Evangelium zu übersetzen in eine Sprache, die die Menschen verstehen, um es in dieser Sprache zu verstehen.” (Päpstliche Verlautbarung 1975). Das ist ein Auftrag!
Der Kern der christlichen Botschaft wird immer in einem kulturellen Kleid mitgegeben, nie im luftleeren Raum. Die Mission bietet die Chance, sich aus neuen Kulturen einen neuen Leib zu schaffen. 1974 spricht sich die afrikanische Bischofskonferenz aus für: Offenheit für die Reichtümer der Teilkirchen. Im folgenden Kapitel möchte ich zeigen, wie indigene Kosmovisionen, am Bsp. meiner Erfahrung in Bolivien, eine Bereicherung und Vervollständigung der kirchlichen Erfahrungen sein können. Bisher war die Kirche fast nur durch die jüdisch-christliche Erfahrungen Europas geprägt. Die Mehrzahl der Christen lebt heute außerhalb Europas und ist in anderen Denkstrukturen und Erfahrungswelten verwurzelt. Dadurch ergaben sich neue Glaubenserfahrungen, die über Jahrhunderte gelebt und je nach Kultur verschieden sind, sich aber gegenseitig bereichern können und damit das Weltverständnis wie auch unsere Glaubenserfahrungen erweitern können. Papst Johannes Paul II. erkannte in diesen nichteuropäischen Kulturen Samenkörner des Reiches Gottes. Sie sollten in der Gestaltung der Kirche mehr Gewicht und mehr Raum bekommen.
Zwischen den südamerikanischen Bischofskonferezen in Medellin 1968 und Puebla 1979 betonten die Bischöfe, dass Kirche aus dem Volk geboren ist, sie ist ein Volk auf dem Weg zur Befreiung, wobei in Lateinamerika die Kirche immer zugleich Sprachrohr der Unterdrückten ist (1978). Die Alltagswelt der Gemeinde wird mithineingezogen, ein lebendigeres Verhältnis entsteht, und durch die realere Basis eine bessere Theologie, ein neuer kirchlicher Führungsstil, Gespräch, gemeinsames Arbeiten, engere Kenntnis und Verbundenheit mit dem Volk. Entscheidend ist ein Aufbau möglichst lebendiger Gemeinden mit einem Minimum an bürokratischer Struktur. Dies geschieht nicht überall in gleicher Weise, je nach Kultur, Charismen und Begabungen. Wichtig ist, sich nicht abzukapseln, sich nicht absolut zu setzen und immer wieder nach dem missionarischen Geist in sich zu fragen.
Anmerkung: Die genannten Dokumente sind schon seit geraumer Zeit veröffentlicht. Die Frage ist berechtigt: Wie hat sich die Struktur der Kirche daraufhin weiterentwickelt? Einen Weg aus dem strengen Hierarchieverständnis heraus sehe ich in der gewachsenen und wachsenden Teilnahme an Zusammenarbeit und Mitbestimmung zwischen Laien und Klerus. Angefangen mit Pfarrgemeinderäten sollte dies wachsen in “höhere” Entscheidungsebenen. Dies zeigt sich heute anfanghaft in der Berufung von Laien in “höhere” Gremien, mit Stimmrecht, bis in die Synoden hinein. Als mögliches Ziel kann ich mir vorstellen: Verantwortung durch ein (geschwisterliches) Team, getragen mit immer mehr Rückbindung an die Basis. Verantwortung und Leitung kann ich mir auch vorstellen als Team mit einer Vertretung, jeweils Frau und/oder Mann aus je einem Kontinent oder Kulturkreis. – In der Sorge um das Überleben der Menscheit auf unserem Planeten zeugt die Enzyklika “Laudato si” von Papst Franziskus von der Wertschätzung der Erfahrungen indigener Völker zum Umgang mit der Natur. Warum diese nicht auch in der Frage nach Organisationsformen zu Rate ziehen?

5. Indigene Kosmovisionen helfen der kirchlichen Organisation
So wie keine Botschaft ohne das Kleid ihrer Ursprungskultur besteht, so ist die Kirche vom Ursprung her jüdisch-christlich geprägt. Durch Ihre Begegnung mit der griechischen Kultur nahm sie deren philosophisches Kleid an, und diese Entwicklung hat die ganze kirchliche und europäische Geschichte geprägt. Die Kirche hat viel gelernt, integriert und drückt sich in ihren Dokumenten und Formen entsprechend aus. Europäer in ihrer (okzidentalen) Kosmovision fühlten sich anderen Kulturen überlegen und drängten sich ihnen auf. Das liegt auch in der europäischen Kosmovision begründet, die von ihrem Ansatz her auf Separation, Ausgrenzung und Monokultur angelegt ist, während die indigene eher auf Komplementarietät, Integration und Offenheit gegenüber Anderem angelegt ist. Monokultur stellt sich religiös als Monotheismus dar, was in der Kirche oft zu Unterwerfung, Ausschluss oder Vernichtung Andersdenkender geführt hat. Im Nichtverstehen anderer religiösen Praktiken wurde Wertvolles, auch Samen des Wortes Gottes, zerstört. In der europäischen, ausschließenden Logik gilt: A ist nicht B, und beides kann nicht gleichzeitig wahr sein. Daher die Vernichtung oder Aufdrängen Andersdenkenden gegenüber. In der indigenen integrierenden Kultur kann beides gleichzeitig bestehen und zu gegebener Situation wahr sein und sich ergänzen, z.B. Tag und Nacht, warm und kalt.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich wesentliche Unterschiede der okzidentalen Kosmovision zu bolivianisch-indigener, von ihren jeweiligen Ursprüngen her, gegenüberstellen (angeregt durch Javier Medina in seinem Buch “Diarquia”, 2006), damit die jeweiligen Werte und Schätze als Bereicherung und mögliche Lösungswege in aktuellen Problemen ersichtlicher werden. Die jüdisch-christliche (europäische) Entwicklung ist geprägt durch eine lineare, zielgerichtete Dynamik, symbolisiert durch einen Pfeil, im Gegensatz zum zyklischen wiederkehrenden Rhythmus indigener Völker. Aus diesem wiederkehrenden Rhythmus wurde Abraham herausgerufen und ging seinen Weg geführt durch Gott. Es entstand lineare Geschichte, Zielstrebigkeit, Entwicklung und Fortschritt. Das führte aber zum Bestreben nach immer weiter, immer schneller, immer mehr. Dieses Bestreben wurde rücksichtsloser und ausbeuterischer, dem Menschen und vor allem der Natur gegenüber. Das indigene Bewusstsein ist jedoch geprägt vom Erhalt von Harmonie und Gleichgewicht, symbolisch durch einen Kreis dargestellt. Mit dem Menschen als Teil der Schöpfung bilden der Respekt und die gute Beziehung zu allem und allen (Gemeinschaft und Zusammenleben mit der Natur), die wichtigste Grundlage. Mit der Pflege der kulturellen Lebensweisen wird das Gleichgewicht in der Natur und dem Zusammenleben erhalten. Da zu Beginn alles gut geschaffen war, suchen die Guarani gelungenes Leben und “das Land ohne das Böse” zu erreichen, indem sie ihren Traditionen folgen.
Eine integrative Begegnung und im Dialog der Kulturen untereinander kann z.B. in die Begegnung von Fortschritt (Pfeil) und Gleichgewichtsbestreben (Kreis) nachhaltige Entwicklung als zukunftsfähigere Lösung ergeben. In anderen Lebensbereichen gäbe es weitere Perspektiven, die aus der Einseitigkeit nur einer Kultur herausführt und für eine bessere Zukunft wichtig sein können. Im indigenen Weltverständnis ist alles mit allem Verbunden. Entsteht ein Schaden, so leidet das ganze System darunter. Dieses Verständnis lässt sich im Bild des Netzes darstellen, während das europäische dagegen eher durch eine Pyramide verdeutlicht ist. Eine Hierachie ist wie eine Pyramide, sie basiert auf Unterordnug, die in soziale Schichten aufgeteilt ist, und eine Wettbewerbsstruktur, in der jeder nach oben strebt. In den unteren Kategorien befanden sich in früheren Zeiten die hart körperlich arbeitenden, rechtlos und ausgebeutet, entgegen dem Willen Gottes. Es ist ein ausschließendes System mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern, während das indigene ein integrierendes ist, in dem alles seinen Platz und seinen Sinn hat.
Um der Pyramide mit ihrer Machtanmassung zu entkommen wäre entsprechend der repräsentativen Demokratie (wie in Deutschland) eine direkte vorzuziehen wie ich sie im indigenen Bereich erlebt habe: in der Versammlung der Gemeinde werden Entscheidungen so lange besprochen bis alle sie mittragen. Die Exekutive darf dann nur das vollstrecken, auf was sich die Versammlung geeinigt hat. Auch eine pyramidale Kirchenstruktur (monokulturelles Denken, Separation und Ausschluss – gegenüber Einstimmigkeit, Komplementarität, Respekt und Integration), kann ein lernender Dialog untereinander zu Evangeliums gemässeren Strukturen führen, basis- und volksgebundener, ohne hierarchische Privilegien, zu Netzwerken unter Brüdern und Schwestern im Glauben. Letztendlich ist es der hl. Geist, der uns, trotz unterschiedlicher kultureller Erfahrungen, eint. Für unseren Glauben ist es wichtig, die verschiedenen Weltbilder/Kosmovisionen zu unterscheiden. In der europäischen Kosmovision, die anthropozentrisch angelegt ist, steht der Mensch im Mittelpunkt, der über der Schöpfung steht, sie beherrscht und ausbeutet. Daher steht darin auch Gott über allem, außerhalb und oft als fern von seiner Schöpfung empfunden wird. Dabei ist im indigenen Denken der Mensch ein Teil der Schöpfung, die er bewahren soll, daher seine familiäre Beziehung, mit den Tieren, der Natur und untereinander. Gott ist in allem und mitlebend und folglich nah und mitleidend und sich mitfreuend. Im ursprünglichen Verständnis der Guarani ist der Mensch ein Wort, das Gott gesprochen hat.
Im Rahmen des Gleichgewichtes und der Harmonie ist Gemeinschaft von höchstem Wert. Niemand lebt allein, da alles mit allem verbunden ist und voneinander abhängt; während die europäische Entwicklung sich um das Individuum als Person und seine Unabhängigkeit bemüht, steht im indigenen Bestreben die Gemeinschaft im Vordergrund, die das Leben der Einzelnen garantiert. Das drückt sich auch in den staatlichen Verfassungen aus: die deutsche beginnt mit der Person als Individuum: “die Würde des Menschen ist unantastbar!” In der bolivianischen Verfassung geht es zuerst um die Gemeinschaft. Sie hat Vorrang vor dem Individuum. Der erste Artikel beginnt mit der Definition des Staates: “Bolivien ist als sozialer Einheitsstaat plurinationalen Gemeinschaftsrechts konstituiert, frei, unabhängig, souverän, demokratisch, interkulturell, dezentral und autonom. Bolivien basiert auf Pluralität und politischem, wirtschaftlichem, rechtlichem, kulturellem und sprachlichem Pluralismus im Integrationsprozess des Landes.”
Zum Autor
Hermann Stoffel, geb. 1955 in Trier. Arbeitete als Priester in Deutschland und Bolivien. In den 1990er Jahren lernte er die damals noch versklavten Guarani im Bundesland Chuquisaca kennen und konnte wesentlich zu deren Befreiungsprozeß beitragen. Später arbeitete er als Entwicklungshelfer in anderen Teilen Boliviens. Er lebt seit über 30 Jahren in Bolivien und setzt sich für indigene Bevölkerung und deren Zukunft ein.

Das Gestalten von Beziehungen ist wichtig, da alles miteinander verbunden ist. Einer der wichtigsten Werte im täglichen Leben ist der Respekt voreinander. Es wird jemandem angekreidet, wenn ihm in einer Situation der Respekt fehlte. Weiterhin kennzeichnend ist die Korrespondenz im Geben und Nehmen, die Reziprozität und das Vertrauen, das Leben als Prozess sehen, nicht statisch. Pluralität zulassen und sie integrieren, Arbeit als Mitarbeit an der Schöpfung, als Fest, nicht als Strafe und Mühe zu sehen. Aus alledem ergeben sich viele Konsequenzen. Jeder ehrliche, wertschätzende Dialog kann bereichernd und weiterführend sein, auch in der Kirche. In den Begegnungen der europäischen Kulturen mit den indigenen, sehe ich oft noch koloniale Haltungen. In der bolivianischen Gesellschaft und Politik, ihrer ihrer Gesetze, wie auch in Projekten, die europäische Kultur stark dominierend. Das gesellschaftliche Zusammenleben und Arbeiten richtet sich ganz selten nach indigenem Verstehen und Verhalten. Auch hier ist ein ernsthafter Dialog nicht nur bereichernd, sondern dringend notwendig. Es sollte keine Zeit verloren gehen, solange die Lebensweisheiten dieser Kulturen noch zugänglich sind.
Fazit
Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Korinth (1 Kor 3, 5-13): Einer säht, ein anderer gießt und ein weiterer erntet. So will ich mit meinen pastoralen und interkulturellen Erfahrungen durch meinem Artikel eine Reflexion anstoßen und das Gespräch über die Hierarchie in der Kirche als Struktur in Gang bringen, in der Hoffnung, dass die Kirche Jesu zu einer Organisationsform findet, die seiner Botschaft entspricht. Ich werfe den Ball ins Spiel, und Sie, Liebe Leserinnen und Leser spielen ihn weiter hin zu verändernden Schritten. Ich möchte im Artikel deutlich machen wie einseitig und schädlich die Hierarchie als Struktur sein kann, durch ihre okzidentale Kosmovision geprägt, für die eine Begegnung mit indigenen Kulturen zu einer wahren Bereicherung und einem Ausweg aus ihrer Einseitigkeit führen kann. Wichtig ist dabei das Erkennen, dass diese Struktur nicht evangeliumgemäss ist.
Das Symbol des Netzes im neuen Testament, aus dem Leben der Apostel als Fischer, kann dazu einladen, die Struktur der Kirche neu zu gestalten, einander verbunden wie in einem Netz, und sie dazu aufrufen ihr Netz erneut auszuwerfen und ihre Berufung als Menschenfischer zu leben. Im Anspruch der Kirche “katholisch” (weltumfassend) zu sein kann sie auch Nichteuropäischen Menschen und Kulturen einen Platz anbieten, an dem diese sich mit ihren Glaubenserfahrungen und Werten im Haus Gottes fühlen. So wird Kirche zu einer Familie zusammenwachsen, die ihre vielfältigen Erfahrungen als Reichtum erlebt. In diesem Dialog, ernsthaft und wertschätzend, lässt die Kirche sich neu als wanderndes und auch voneinander lernendes Volk Gottes erleben.
Hermann Stoffel






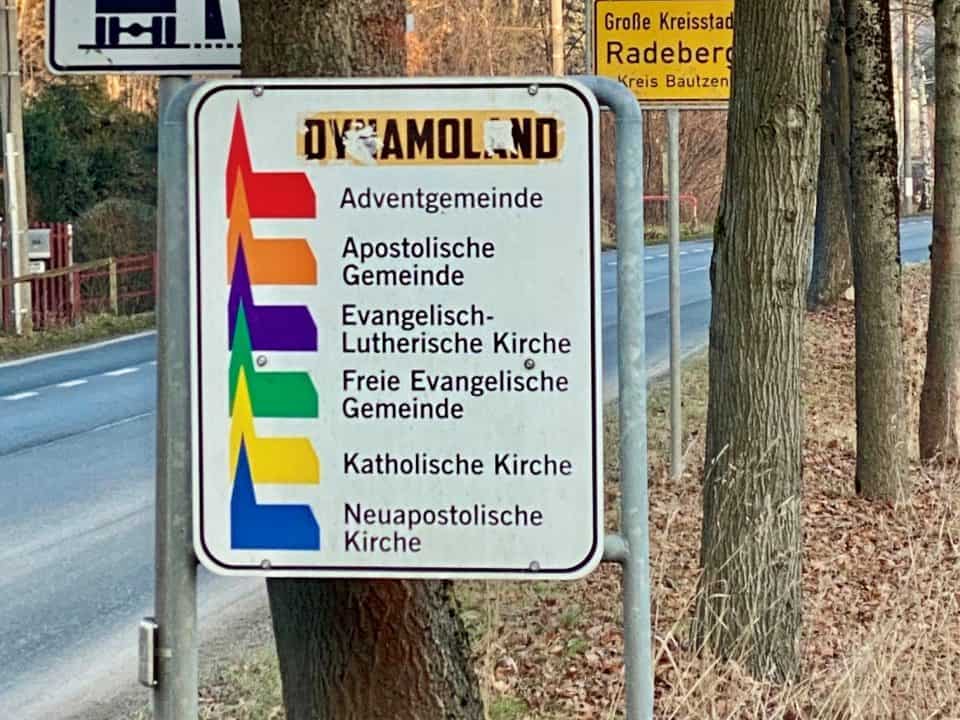

1 Rückmeldung
Schön Dich so munter zu sehen und zu hören. Auf dem Bild siehst Du (und Ihr) gut aus, besser als bei unserem letzten Treffen, meine ich mal. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen, du alter Kämpfer. Die ganze
Hierarchie mal vollständig abschaffen. Mmmmh….
Bei Zustimmung in einzelnen Teilen und in Deiner Grundintention stimme ich dir im Wesentlichen nicht zu. Dein Ritt durch die biblische Geschichte und die Kirchengeschichte weist einige fasche Idealisierungen auf und wichtige Auslassungen. Mir gefällt z.B. nicht, dass Du von der apostolischen Zeit bis zur konstantinischen Wende nix erzählst. 313 sei es losgegangen mit falschen Hierarchien. Trotz immer auch guter Hirten war es ein großer Fehler, dass grob gesagt ab da nur noch die Kleriker als aktive Träger kirchlichen Lebens galten und die Laien als bevormundete passive Mitglieder. Warum erzählst du aber nichts von den dreihundert Jahren vorher, wo seit biblischen Tagen hierarchische Ämter selbstverständlich waren. In der Märtyrerzeit gab es viele hervorragende Bischöfe etwa. Die in den neutestamtlichen Briefen im Keim vollständig vorhandene Ämtertheologie entfaltet sich und steht nicht im grundsätzlichen Gegensatz zur paulinischen Gemeinde- und Leib Christi-Theologie.
Das Zeite Vatikanum erst schafft wieder neue Synthese zwischen apostolischen Dienstämtern und gemeinsamem Priestertum aller Gläubigen. Darum ist es auch meine Überzeugung, dass wir hier anknüpfen müssen und Laienapostolat und Hierarchie zusammenhalten sollen. Deiner totalen Abschaffung der Hierarchie stimme ich nicht zu. Es wird dann andere geben, die das Sagen haben, wahrscheinlich die, die am besten und lautesten reden können, Zurück zum AT: Königszeit von Saul bis zum Babylonischen Exil gleich üble Phase. Danach habe Israel zu wahrerer Identität gefunden. So ganz toll kann es auch danach nicht gewesen sein, den es gab auch spätere Propheten, die viel zu kritisieren hatten etwa an der Priesterschaft und auch an Vermischungen mit anderen Religionen (Maleachi war das letzte bilbische Buch, das ich kürzlich ganz las.) Und was war vor der Königszeit? Viel Hierarchie bei den Patriarchen und auch bei Mose, Richter, Richterinnen.
Lieber Hermann, von unseren Eifeldöfern und Moseldöfern kennen wir kommunale Demokratie in den Gemeinderäten. Den Bürgermeister nannten wir trotzdem Vorsteher. Vielleicht berührt es etwas Deine bolivianische Kosmovision, der wohl zuzustimmen ist. Kirchlich jedenfalls würde ich lieber weiter die Synthese des Zweiten Vatikanums verfolgen und das apostolische Amt und die Sache mit den „Wo zwei oder drei…“ zusammenhalten wollen in der Hoffnung dass Amtsträger, Gemeindeleiterinnen und Normalo-Taufchristinnen zusammen Kirche in der Welt von heute sind.