Sterbehilfe im Gefängnis soll in der Schweiz grundsätzlich möglich sein: Das empfiehlt das Grundlagenpapier einer Expertengruppe, das von den Kantonen diskutiert wird. Bisher war in der Schweiz nicht geregelt, ob auch eine inhaftierte Person Sterbehilfe beantragen darf. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) will dies ändern und hat die Vorschläge einer Expertengruppe bei den Kantonen in die Vernehmlassung gegeben. Es ruft in Erinnerung, dass Menschen in Haft laut Gesetz dieselben Rechte und Pflichten haben wie Menschen in Freiheit. Ein Postionspapier vonseiten der schweizerischen Gefängnisseelsorge mit 10 Thesen.
Der Sterbewunsch eines urteilsfähigen Inhaftierten sei deshalb zu beachten. Entsprechend müsse den Gefängnisinsassen das Recht auf Inanspruchnahme einer Suizidhilfeorganisation zugestanden werden. Für die Beurteilung eines Gesuchs sollen gemäß Grundlagenpapier die gleichen Richtlinien gelten wie bei nicht inhaftierten Personen. Auch im Grundlagenpapier des Schweizerischen Kompetenzzentrums des Justizvollzuges (SKJV) wird ähnlich argumentiert. Die Erlaubnis zum Rückgriff auf eine Sterbehilfeorganisation im Strafvollzug solle nur als Ultima Ratio erfolgen. Vorher müsse geprüft werden, „ob sich das Leiden der sterbewilligen Person nicht beispielsweise durch angepasste Unterbringungsbedingungen, somatische oder psychotherapeutische Behandlungen oder palliative Maßnahmen so weit mindern lässt, dass der oder die Betroffene von seinem/ihrem Sterbewunsch absieht“.

1. These
Das Gefängnis ist kein Ort, um zu sterben
Gefängnisse sind Orte, die ihrem Wesen nach nicht auf Dauer hin angelegt sind, sondern Durchgangsstationen, in denen darum gerungen wird, Leben in der Gesellschaft wieder zu ermöglichen. Gefängnisse sind Transitorte, die dem Gedanken der Resozialisierung verpflichtet sind. Erst einem stärker werdenden gesellschaftlichen Sicherheitsbedürfnis ist es geschuldet, dass die Transitzeiten höher ausfallen und die Aufenthaltsdauer länger werden kann. Gerade diese Entwicklung sorgt unter gefangenen Menschen für enormen psychischen Druck. In der Seelsorge wird die Furcht vor dem Sterben und Tod regelmäßig als eine der größten Ängste geäußert. Jeder Tod, sei es krankheitsbedingt oder einem Suizid geschuldet, sendet Schockwellen durch die Gruppe der Mitinsassen. Da Gefängnisse keine heimatlichen Gefühle der Geborgenheit evozieren können und sollen, wird etwa bei schweren Krankheitsverläufen von Insassen der Prozess des Sterbens vom Justiz- in das Gesundheitswesen (bzw. eine Verbindung beider Institutionen) ausgelagert. Neben dem mit einem Tod im Freiheitsentzug verbundenen administrativen Unbill, wissen die Institutionsverantwortlichen darum, wie belastend Sterben und Tod im Gefängnis wahrgenommen werden. Diese Erfahrungen sollten nicht negiert werden, indem das Gefängnis im Sonderfall des assistierten Suizids zum Sterbeort deklariert wird. Gefängnisse sollten zudem nicht mit der Aufgabe belastet werden, schwerstkranke Menschen zu betreuen, da Menschen, die Ganztagespflege benötigen, in geeigneten Institutionen des Gesundheitswesens angemessener behandelt werden können.
2. These
Die Begleitung kranker, leidender, verzweifelter und sterbender Menschen gehört zur Kernkompetenz der Seelsorge. Gerade beim Thema des assistierten Suizids im Freiheitsentzug kann die Seelsorge mit ihren Erfahrungen und Zugängen ihren Beitrag als wertvolle Ressource leisten.
Seelsorgende in Spitälern, Kliniken, Alters- und Pflegheimen, Demenzzentren, Sterbehospizen, in der Jugendarbeit und in der Arbeit mit Menschen, die gesellschaftlich am Rand stehen, in der Suizidpostvention, aber auch Pfarrpersonen oder Pfarreileitungen bzw. pastorale Mitarbeitende in den Pfarr- und Kirchgemeinden begleiten kranke, leidende, verzweifelte trauernde, einsame und sterbende Menschen seit Generationen. Hier liegen Kernkompetenzen der Seelsorge, die auch in der universitären Aus- und Weiterbildung, mit Super- und Intervision stetig weiterentwickelt wurden und werden. Die Vielzahl pastoralpsychologischer, ethischer und systematisch-dogmatischer Publikationen zu diesen Themen belegt eine enorme Bandbreite und Tiefe in der Auseinandersetzung mit den genannten Problemfeldern. Es werden verschiedene Methodik-Ansätze in diese Themenfelder integriert. In der Gefängnisseelsorge sind diese Kernkompetenzen ebenso wie in allen anderen Bereichen der Spezial- oder Gemeindeseelsorge vorhanden. Die Gefängnisseelsorge ist sich jedoch darüber im Klaren, dass ihre institutionell bedingten besonderen Rahmenbedingungen noch einmal andere Überlegungen hervorrufen müssen, als dies sonst der Fall ist. Gerade die seelsorgliche Schweigepflicht ermöglicht Gefangenen eine weniger angstbesetzte und freiere Kommunikation, die unabhängiger von repetitiven Erfahrungen asymmetrischer Machtverteilung ist. Dies führt letztlich dazu, dass Bagatellisierungen, Externalisierungen und Manipulationen weniger notwendig sind. Im Kontext der Diskussion über mögliche Entscheidungen zum assistierten Suizid und in der institutionellen Bearbeitung dieser Problematik auf seelsorgliche Kernkompetenzen zu verzichten, heißt, wichtige Ressourcen ungenutzt zu lassen.
3. These
Menschen im Freiheitsentzug haben grundsätzlich andere Lebensbedingungen als Menschen außerhalb der Mauern. Psychische, soziale, ökonomische und schuldbedingte Mangelerfahrungen verstärken bei Menschen im Freiheitsentzug oft bereits vorhandene Selbstwertprobleme. Dieser u.a. daraus resultierenden hohen Vulnerabilität entspringt die Fürsorgepflicht, welche gerade beim Thema des assistierten Suizids Beachtung finden muss.
Der Vorstand des Schweizerischen Vereins für Gefängnisseelsorge weist darauf hin, dass, unabhängig von grundsätzlichen theologischethischen Erwägungen, die Gefängnisseelsorge ihre Stimme hörbar werden lassen muss, da die Situation inhaftierter Menschen speziell ist und dieser Besonderheit in allen Überlegungen zum Umgang mit assistiertem Suizid im Freiheitsentzug Rechnung getragen werden muss. Außerhalb der Mauern ist der Austausch zu körperlichen und psychischen Entwicklungen mit Angehörigen, Freunden, Fachpersonen oder Beratungsstellen uneingeschränkt verfügbar. Strukturelle Gewalterfahrungen, die dem Freiheitsentzug trotz all seiner grossen Bemühungen um einen menschenwürdigen Strafvollzug inhärent sind, sind extramural zwar individuell nicht ausgeschlossen, aber deutlich seltener. Veränderungen in Bezug auf Ort, Arbeit oder soziales Umfeld sind – wenn überhaupt – nur unter großen Mühen herbeizuführen. Was es heißt, sozial exkludiert, ökonomisch am Ende und unter stetem psychischem Druck zu sein, kann man sich kaum vorstellen.

Das Wissen um die eigene Schuld, um möglicherweise nicht wiedergutzumachende Straftaten und um die Folgen für Menschen, die einem nahe stehen, lassen den Selbstwert bei vielen Straftätern tief sinken. Der Gesetzgeber weiß um diese Zusammenhänge und spricht deshalb in Art. 75 StGB davon, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken. Damit ist der Zusammenhang von Vulnerabilität und Fürsorge etabliert worden. Bezogen auf den assistierten Suizid bedeutet dies, Gefangenen extramurale Lebensperspektiven aufzuzeigen und Möglichkeiten zu schaffen, die dazu geeignet sind, zu verhindern, dass aus Mangelerfahrungen verknüpft mit geringem Selbstwert so tiefe existenzielle Krisen entstehen, dass der Tod sinnvoller als das Leben erscheint. Es sollte deshalb neben den bisherigen Bemühungen (60 plus in Lenzburg, Spezialabteilung der JVA Cazis-Tignez, Pilotprojekt für Verwahrte in der JVA Solothurn oder Abteilung Alter und Gesundheit in der JVA Pöschwies) weiterhin geprüft werden, wie verwahrte, alte oder kranke Menschen angemessen untergebracht werden können. Die Fürsorgepflicht der staatlichen (Zwang ausübenden) Institution schließt ebenso ein, dass die Angst der Insassen vor einer Konfrontation mit dem Tod ernst genommen werden sollte. Eine Verbindung von Sterbezellen in freiheitsentziehenden Institutionen und assistiertem Suizid könnte beängstigend wirken.
4. These
Die Zeit einer Strafuntersuchung bis zum rechtsgültigen Urteil ist enorm belastend. Dies zeigen die Zahlen der Suizide bzw. Suizidversuche in dieser Phase. Wünsche nach assistiertem Suizid sind als Hinweise auf grosse Not und Verzweiflung am eigenen Leben wahrzunehmen.
Während der Strafuntersuchung ist das Haftregime am strengsten. Die Aufschlusszeiten sind kürzer, die Betreuung in ärztlicher, psychiatrischer, sozialarbeiterischer und psychotherapeutischer Hinsicht kann nur basal erfolgen. Seelsorge weiß dies, da sie in dieser Haftphase mit Inhaftierten einen engen Kontakt pflegt. Sie weiss, wie schambesetzt, verstörend und am Lebenswillen nagend diese Zeit der Unsicherheit erlebt werden kann. Dies alles führt dazu, dass Suizide bzw. Suizidversuche in dieser Phase häufiger als nach einem rechtsgültigen Urteil und im Strafvollzug sind. Die Seelsorge appelliert eindringlich an die Verantwortlichen, Äußerungen nach assistiertem Suizid oder über die eigene Suizidalität als das anzusehen, was sie sind: Hilferufe von zutiefst verzweifelten Menschen in einer Situation, die psychisch kaum zu ertragen ist. Prozesse, die einen assistierten Suizid abklären sollen, sind in dieser Phase kontraproduktiv, da sie von der hochbelastenden psychischen Wirklichkeit ablenken. Die Seelsorge kann hier spirituellen Halt geben und sich als verlässliche Partnerin für Insassen und Institution erweisen.
5. These
Der Wunsch nach Suizid verweist auf eine tiefgehende existenzielle Krise und beschreibt somit gerade keine freie, rationale Entscheidung, sondern einen Ausnahmezustand mit höchst eingeschränktem Zugang zu reflektiertem Handeln.
Es ist zumeist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, weshalb Menschen ihr Leben als nicht mehr Text lebenswert erachten. Persönliche existenzielle Krisen mit seelischen Schmerzen bringen Menschen in einen psychischen Ausnahmezustand, lebensorientierte Pläne und das Wissen um den Wert des eigenen Lebens sind nicht mehr zugänglich. Inhaftierte haben, wenn man Risikofaktoren (Persönlichkeitsstörungen, Mobbing und Bedrohung durch Mitgefangene, Einzelzellen, Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen von mehr als 18 Monaten) kumulativ betrachtet, ein fast vierfach erhöhtes Suizidrisiko. Sinnverlust, fehlende Sinnhaftigkeit, Vorstellung zukünftigen Leidens und andere Faktoren ergeben gerade im Umfeld des Gefängnisses eine Perspektivlosigkeit, die in einen Ausnahmezustand führen kann. In solchen Ausnahmezuständen handeln Menschen nicht rational und sind kaum in der Lage Optionen gegeneinander abzuwägen.
Gefängnis ist ein Ausnahmezustand im Leben eines Menschen. Dauert diese Phase länger an, wird es zu zwei möglicherweise entgegenlaufenden Bewegungen kommen: der Insasse wird sich im Gefängnis einrichten und er wird sein Leben zunehmend als perspektivlos erleben. Unter der Oberfläche eines scheinbaren Akzeptierens der Situation baut sich großer Druck auf. Wenn sich an den Perspektiven nichts ändert, wird auch der Zeitfaktor kaum eine Veränderung herbeiführen. Das Kriterium eines „dauerhaft erwogenen Wunsches“ erweist sich möglicherweise in dieser komplexen Situation als weitgehend ungenügend. Kommen dann noch abschlägige Vollzugsentscheide, entmutigende Gutachten, ablehnende Fachkommissionsempfehlungen oder die Aussicht auf hohe Haftstrafen hinzu, kann sich der Wunsch nach einem assistierten Suizid aus Frustration über die Perspektivlosigkeit verfestigen. Deshalb sind institutionelle und tatbedingte Umstände als wichtige Faktoren immer mit zu reflektieren und die Frage nach möglichen Perspektiven zu klären.
6. These
Der Begriff des „unerträglichen Leidens“ sollte nicht grundsätzlich für soziale oder psychische Deprivation oder eine stark eingeschränkte Lebensperspektive Verwendung finden, sondern möglichst, wie im medizinischen Bereich im Moment noch üblich, nur auf terminale physische Erkrankungen Anwendung finden.
Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) veröffentlichte im Mai 2018 die Publikation „Zum Umgang mit Sterben und Tod“, die sich durch folgende Formulierung von früheren Verlautbarungen unterschied: „[Es ist] nicht der medizinisch objektivierbare Zustand, der bei der Patientin zum selbstbestimmten Suizidwunsch führt, sondern das subjektiv erlebte unerträgliche Leiden.“ Mit dieser Formulierung eröffnen sich im Umfeld des Gefängnisses auf geradezu besorgniserregende Weise Interpretationsmöglichkeiten eines subjektiv unerträglichen Leidens: Lebenslange Freiheitsstrafen, Verwahrung, verlängerbare Maßnahmen, Leben mit unerträglicher Schuld, sozial massiv geächtete Straftaten (wie etwa pädophile Delikte), die Aussicht darauf, auch nach einer Strafentlassung sozial exkludiert zu bleiben usw. Hier liegen vor allem soziale, ökonomische und psychische Lebensthemen vor, die so stark beengend wirken können, dass sie einen Menschen nur noch eingeschränkt „funktionieren“ lassen und subjektiv unerträgliches Leiden konstituieren.
Die Gefängnisseelsorge plädiert dafür, die von der FMH (Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte) beibehaltene Regel, assistierte Suizide im Umfeld des Freiheitsentzugs strikt auf den Begriff der terminalen physischen Erkrankung anzuwenden. Der weit öffnende Terminus des subjektiv unerträglichen Leidens ist zu vermeiden und widerspricht im Kern dem Fürsorgegedanken des Justizvollzugs gegenüber dem sich im Sonderstatusverhältnis befindenden Gefangenen. Informationen über palliativmedizinische Versorgung – wie sie in der Patientenbetreuung auch im Gefängnis zum Standard gehören – können zudem helfen, Ängste am Lebensende zu minimieren. Viele Gefängnisseelsorgende verfügen außerdem über Kompetenzen in der Palliative Care, die in den Betreuungsprozess involviert werden können.
7. These
Das Personal der Justizvollzugsanstalten ist vor weiteren schweren Belastungen zu schützen. Dies gilt in besonderer Weise für die hochbelastende Phase, wenn Menschen den Wunsch nach assistiertem Suizid äußern und Gesprächspartner suchen. Diese sollten jedoch seelsorglich, psychiatrisch oder psychotherapeutisch ausgebildet sein.
Es scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass es dem Personal einer Justizvollzugsanstalt nicht zuzumuten ist, die Zusatzbelastungen auf sich zu nehmen, die Gespräche, Entscheidungsprozesse oder wiederholt geäußerte Wünsche nach assistierten Suiziden mit sich bringen. Der Vorstand des Schweizerischen Vereins für Gefängnisseelsorge setzt sich dafür ein, die im Alltag bereits stark belasteten Mitarbeitenden des Justizvollzugs zu schützen. Gesprächsprozesse gehören in jene Berufsgruppen delegiert, die aufgrund ihrer Aus- und Weiterbildung und ihrer langjährigen Praxis besonders geeignet sind, solche Gespräche zu begleiten. Hier sollte neben dem Arztdienst (sofern das im Gefängnis überhaupt möglich ist), den psychiatrischen und den psychotherapeutischen Diensten vor allem auch die Seelsorge ihre Kernkompetenzen einbringen.
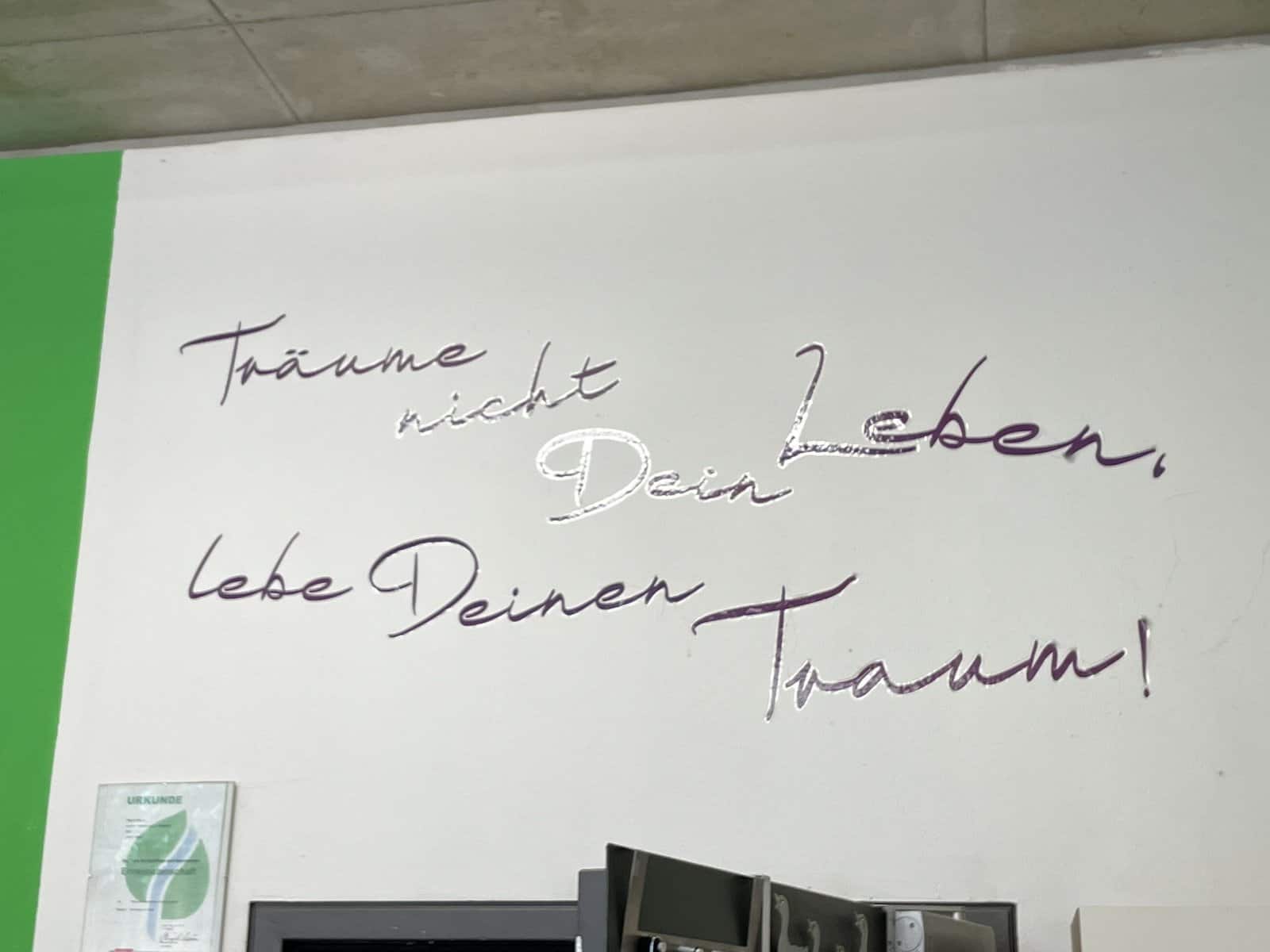
8. These
Der Tod eines Insassen hat im Freiheitsentzug für die Mitinsassen enorme Bedeutung. Im Wissen um diese Bedeutung und unter den Bedingungen einer Zwangsgemeinschaft ist deshalb von der Durchführung des assistierten Suizids in Gefängnissen abzusehen.
Noch einmal sei darauf hingewiesen, welche enormen psychischen Auswirkungen der Tod im Gefängnis auf Mitinsassen haben kann. Die Seelsorge hat nach einem Suizid oder krankheitsbedingten Tod im Gefängnis oft noch wochenlang in Gesprächen diese Thematik zu bearbeiten. Da sich Mitgefangene in einer Zwangsgemeinschaft eigener Art befinden, die keinesfalls mit einer in einem Alters- oder Pflegeheim verglichen werden sollte, aus der sie sich nicht durch eigenes Zutun befreien können, muss der Fürsorgegedanke sich in ganzer Breite entfalten können. Neben der Angst, die der Tod im Gefängnis bei den allermeisten Gefangenen auslöst, der Furcht eines Sterbens in Unfreiheit, muss auch noch der Druck bedacht werden, wenn Mitinsassen realisieren müssen, dass sich jemand, der sich in einer vergleichbaren Situation befindet, für den Tod entschieden hat. Ethisch ist zumindest danach zu fragen, ob die aus einer durch Perspektivenmangel entstandene Belastung eines Einzelnen rechtfertigt, dass er sein Recht auf einen selbstbestimmten Tod wahrnimmt, wenn sich damit gleichzeitig die Belastung der anderen Mitgefangenen erhöht. In allerletzter Konsequenz ist danach zu fragen, ob sich hier für Insassen nicht die Möglichkeit einer gleichsam selbstgewählten und relativ sanft auszuführenden Todesstrafe eröffnen würde. Inwiefern eine solche Möglichkeit in Verbindung mit der hohen Verletzlichkeit inhaftierter Menschen noch als human oder menschenrechtskonform angesehen werden könnte, sei hier zur Diskussion gestellt. Zu beachten ist hierbei, dass bei einer Verwahrung nach Art. 64 StGB die Strafe bereits verbüsst ist. Würde der Weg eines assistierten Suizids aus Gründen eines subjektiv unerträglichen Leidens eröffnet, käme dies einem Paradigmenwechsel im auf Resozialisierung setzenden Justizvollzug nahe.
9. These
Menschen, die eine hoffnungsvolle Perspektive haben, werden seltener den Wunsch nach einem assistierten Suizid verspüren. Deshalb muss der Justizvollzug gerade bei den vulnerabelsten Gruppen (Massnahmenvollzug, lebenslange Freiheitsstrafe, Verwahrung) Wege finden, Perspektiven offen zu halten oder neu zu schaffen. Hier ist auch die seelsorgliche Begleitung als Ressource wahrzunehmen.
Wenn man, wie es die Gefängnisseelsorge tut (übrigens in Übereinstimmung mit dem BGE 136 II 415 vom 16. Juni 2010 8), Suizidwünsche als Ausdruck existenzieller Notlagen begreift, wird man nicht nach Wegen suchen, die den assistierten Suizid im Freiheitsentzug ordnen, regeln und verwalten sollen, sondern danach fragen, welche Möglichkeiten es geben könnte, Perspektiven für diejenigen zu schaffen, die in Not sind. Im Rechtsgutachten „Suizidhilfe im Freiheitsentzug“ von Brigitte Tag und Isabel Baur vom Juli 2019 wird zumindest die theoretische Möglichkeit offengelassen, dass die Haft selbst als Grund für unerträgliches Leiden gewertet werden könnte. Es ist also keineswegs geklärt, dass nicht ein Gericht diese Argumentation stützen und so den Weg zu den oben beschriebenen Interpretationen öffnen könnte.
Wenn jedoch Haft unerträgliches Leiden hervorruft, lässt sich vermuten, dass dies überall dort der Fall sein kann, wo die Unsicherheit bezüglich möglicher Perspektiven sehr hoch ist, also bei Menschen, die sich in Untersuchungshaft befinden und bei den bereits erwähnten Gruppen mit eingeschränkter Zukunftsperspektive. Um hier Erleichterung zu verschaffen, sollte alles Mögliche getan werden, um Perspektiven zu erhöhen. Es ist neben der realistischen Aussicht auf Vollzugslockerungen an humanitär bedingte kurzfristige, begleitete Ausgänge zu denken, ebenso wie Versöhnungsprogramme mit Angehörigen und erleichterter und verstärkter Kontakt mit engen Familienangehörigen und Kindern, z.B. auch durch Videotelefonie. Es ist dem Vorstand des Schweizerischen Vereins für Gefängnisseelsorge bewusst, dass es hierzu eines Kulturwandels und eines Paradigmenwechsels bedürfte und beides für den Justizvollzug eine Herausforderung darstellen kann. Die Seelsorge vor Ort ist bereit, sich in hohem Maß zu engagieren, um beides mitzutragen und mitzugestalten.
10. These
Das Thema der Angehörigen und deren Belastungen muss in den Diskussionen eine viel gewichtigere Stellung bekommen, als dies bis heute der Fall ist. Die zahlreichen Erfahrungen mit versöhnendem Handeln und mit Methoden der Restorative Justice sollten hier einfließen und genutzt werden.
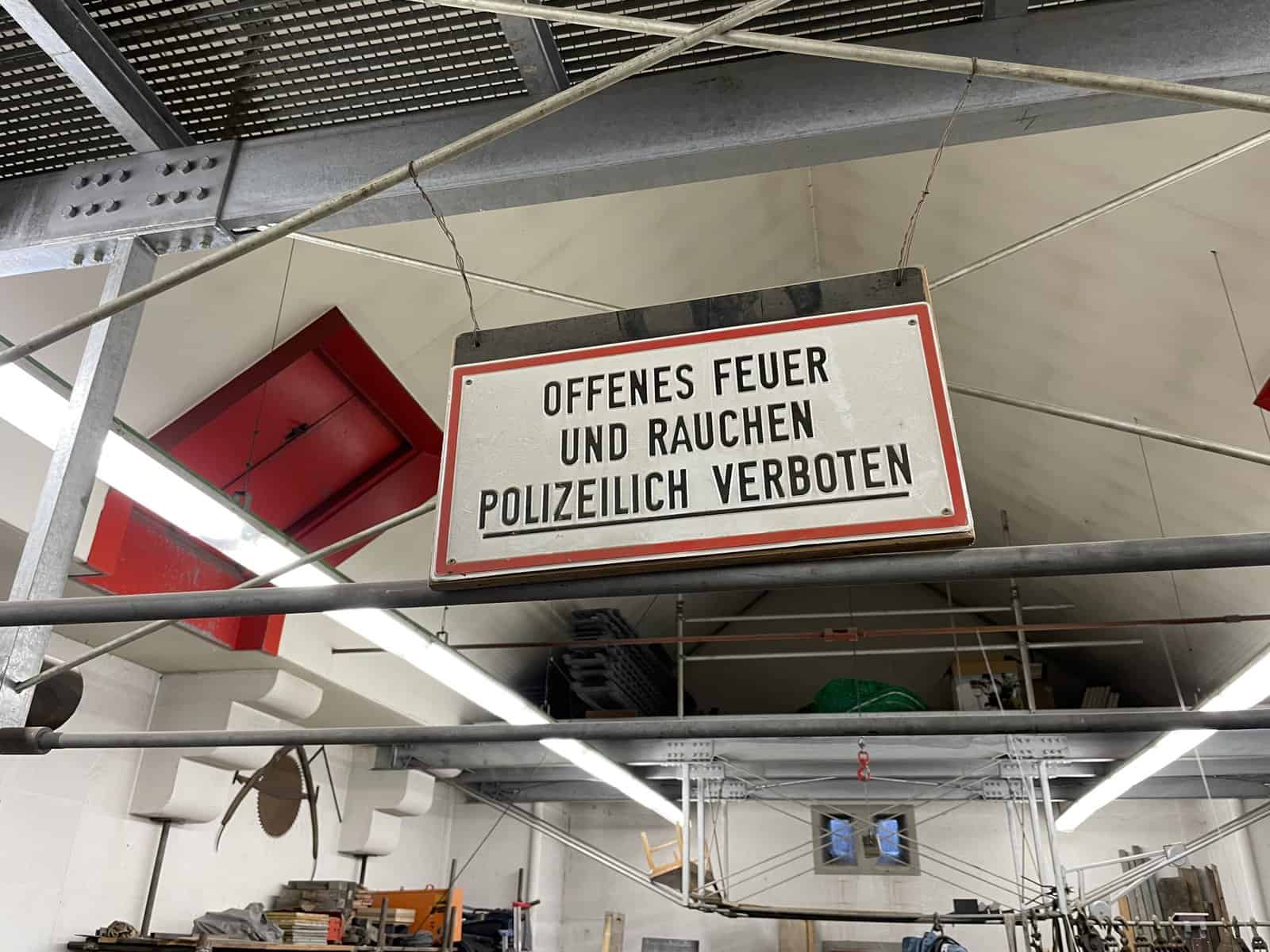
Angehörige sind häufig in die Entscheidungsfindung eines assistierten Suizids involviert. Daraus können für Angehörige moralische Dilemmata entstehen, die in Schuldgefühlen enden können. Angehörige überfordern sich manchmal, indem sie mithelfen, obgleich nicht von der Entscheidung überzeugt, den Suizid zu organisieren und dem Suizidwilligen die letzte Lebensphase so angenehm wie möglich zu machen. Dabei ist die Belastung für Angehörige deutlich höher als bei einem natürlichen Todesfall. 40 % leiden anschließend an einer Posttraumatischen Belastungsstörung, einer Depression oder einer komplexen Trauerreaktion. Bedenkt man nun, welch großen Belastungen Angehörige als „vergessene Opfer der Straftat und des Strafrechts“ sowieso bereits ausgesetzt sind, dass sie den Prozess nicht im selben Maß wie Angehörige draußen miterleben und -gestalten können, dass Insassen durchaus dazu neigen, Angehörigen schwierige Themen zu verschweigen, um sie nicht weiter zu belasten, dann wird klar, welche psychischen Belastungen auf nahe Angehörige zukommen können.
 Bislang sind diese nicht in der Diskussion erwähnt worden. Wir weisen deshalb darauf hin, dass es ebenfalls die Lebensperspektive eines Insassen verbreitern kann, wenn man mit ihm an der Versöhnung mit seiner Familie arbeitet. Die dazu nötigen Erfahrungen sind in der Gefängnisseelsorge vorhanden, sie verfügt über notwendige Kenntnisse der Methoden von Restorative Justice, die für Versöhnungshandeln hilfreich sein können.
Bislang sind diese nicht in der Diskussion erwähnt worden. Wir weisen deshalb darauf hin, dass es ebenfalls die Lebensperspektive eines Insassen verbreitern kann, wenn man mit ihm an der Versöhnung mit seiner Familie arbeitet. Die dazu nötigen Erfahrungen sind in der Gefängnisseelsorge vorhanden, sie verfügt über notwendige Kenntnisse der Methoden von Restorative Justice, die für Versöhnungshandeln hilfreich sein können.
Veröffentlicht mit Genehmigung des Verlags für Gefängnisseelsorge
und dem Schweizerischen Verein für Gefängnisseelsorge






