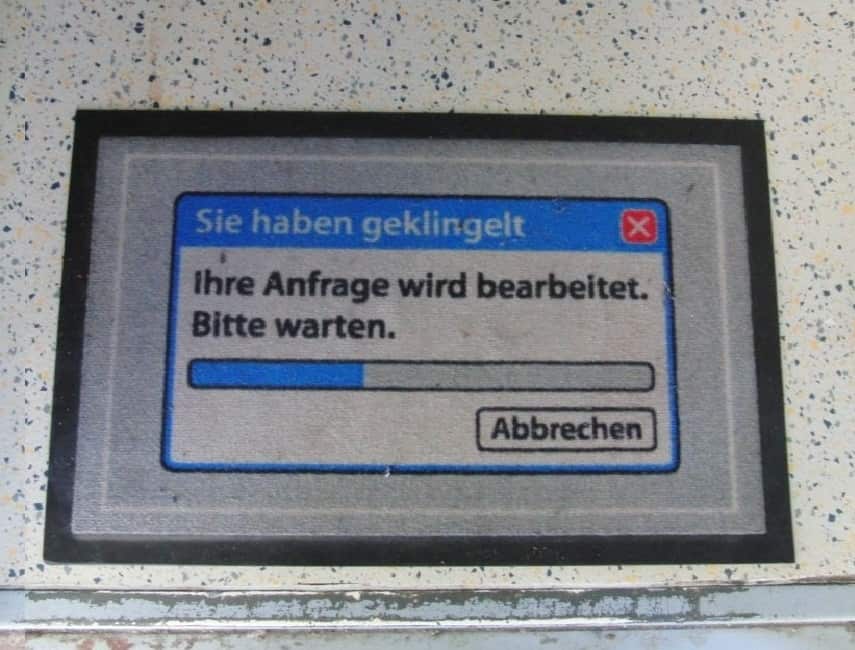Niemand wartet gern. Doch wer entscheidet, ob und wie wir warten? Angespannt oder resigniert, geduldig oder zuversichtlich? Schätzen wir Dinge mehr, auf die wir lange gewartet haben? Wir alle warten, immer wieder – auf das Gerichtsurteil, im Verkehrsstau, im Krankenhaus, auf Weihnachten, auf den Schlaf, auf das erlösende Fußball 1:0. Warten ist Teil unseres Lebens und oft mit Hoffnung verbunden. Dabei wird das Warten nicht selten als leere oder gestohlene Zeit erlebt, als langweilig und quälend. Im Gefängnis warten Gefangene auf die Entlassung. Sie sitzen „ihre Zeit“ ab. Man kann sich nicht mit dem Smartphone ablenken. Und doch kann „das Absitzen“ Orientierung und Einstimmung auf ein verändertes Leben sein.
Wiktionary („das freie Wörterbuch“) gibt für das deutsche Wort „warten“ zwei Bedeutungen an, eine transitive = „technische Apparate pflegen und eventuell regelmäßig reparieren“, die in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung ist, und eine intransitive = „Zeit verstreichen lassen beziehungsweise untätig sein, bis ein bestimmter Zustand eintrifft“. Definiert man „warten“ als Nichtstun, bis das Erwartete (oder etwas ganz anderes) eintritt, leuchtet das auf den ersten Blick ein. Wer wartet, macht nichts Gezieltes, er beschäftigt sich allenfalls mit diesem und jenem, vertreibt sich die (Warte-)Zeit. Dieses Warten ist „verdächtig“, weil es unproduktiv erscheint. Besser etwas zu tun, als zu warten. Untätig sein, heißt Zeit verlieren. Unter der Überschrift „Lesen statt warten“ hat ein Verlag sogar eine Schöner Warten App angeboten.
 Ein anderer Akzent des Wartens
Ein anderer Akzent des Wartens
Einen bemerkenswert anderen Akzent setzt Wikipedia in der Definition des Wartens. Auch hier wird die technische Bedeutung genannt, die Gerätewartung, als weitere Bedeutung wird aber angegeben: „Das Warten (als Verb ‚warten, abwarten, zuwarten’), ein Ereignis kommen zu sehen und dessen ‚gewärtig’ zu sein.“ Der Verweis auf die Stichwörter „Warteschlange“ und „Wartesystem“ berührt dann einen Bereich (Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Umgang mit Kunden in der Wirtschaft und Verwaltung), von dem ich zwar gelegentlich (etwas beim Nummernziehen in der Schlange) betroffen bin, in dessen theoretischen Grundlagen ich mich jedoch nicht auskenne. Hier ist das Warten nicht verstanden als Zwangspause im Betreib, sondern als Ausrichtung auf etwas Kommendes, das im Warten schon seinen Einfluss geltend macht.
Solche Überlegungen wirken zunächst etwas banal, läppisch, unbedeutend. So ist es doch! Schon mit den beiden schnellen Stichproben spannt sich allerdings ein Feld ganz unterschiedlicher Einstellungen und kultureller Muster auf: Hier das Warten als drohender Verlust von Zeit (und Geld), dort das Warten als Orientierung, als Ausrichtung und Einstimmung auf Neues.
Warten – biblisch und adventlich
In der Bibel wird das Thema des Wartens intensiviert. Es erhält ein solches Gewicht, dass es zur Lebenshaltung, geradezu zum Daseinsinhalt wird: Der biblische Psalmdichter empfiehlt seinem Volk: „Israel, warte auf den Herrn!“ (Ps 130,5), nachdem er zuvor von sich selbst bekannt hatte: „Meine Seele wartet auf den Herrn“ (mehrfach in Variation in Ps 130, 4 und 5). Umschrieben heißt das: Auf Gott zu warten, macht die Mitte meines Lebens und den Sinn meiner Existenz aus. Warten ist hier weit entfernt vom möglicherweise in Verlegenheit führenden Nichtstun. Aber wie ist das Erwartete, genauer: der Erwartete, Gott, gegenwärtig? Stellt man diese Frage an die Bibel, so kann man überraschende Entdeckungen machen.
- „Die (auf Gott) Wartenden“ kann zu einer Bezeichnung der Glaubenden werden. Das Warten gehört nicht nur zum Glauben an den Gott der Bibel, sondern es ist Inbegriff des Glaubens (vgl. Psalm 52,3 und 37,9). Die Mitte des Glaubens ist genau dies: die Erwartung Gottes. Das biblische Glaubensverständnis setzt einen deutlichen Akzent: „Ich warte auf dich, Gott!“ Das sagen zu können, ist viel schwieriger, als Katechismus-Sätze nachzuvollziehen oder zu diskutieren. Ein solcher Satz beansprucht – mich, und zwar mit Verstand und Gefühl. Er lässt nicht zu, dass ich mich zurücklehne und abwäge, um dann Stellung zu beziehen. „Ich warte auf dich, Gott.“ – Dieser Satz ist wie ein Gebetswort.
- Ein solcher Satz macht zuerst einmal die Unsicherheit bewusst, die aus dem Schweigen und der Ferne Gottes kommen. Erfahrungen der Abwesenheit Gottes sind nicht erst Problem einer kritischen Moderne, für die Gott zunehmend unplausibler geworden ist. Die Rede vom Warten auf Gott hat ihren Sitz in der Erfahrung des Abstandes zu Gott, ja, der Fragwürdigkeit Gottes. Es ist ein Ruf „aus der Tiefe“ (vgl. Psalm 130) und aus dem „Umschlungensein“ (vgl. Psalm 18), so die eindrücklichen biblischen Bild für die Erfahrung der Gefährdung und der Rat- und Hilflosigkeit, der (Gott-)Verlassenheit. Der Beter kann sogar den Vorwurf an Gott richten: „Du hast mich aus dem Shalom (Frieden) herausgestoßen, ich habe vergessen, was Glück ist. Ich sagte: Dahin ist mein Glanz und mein Harren auf den Herrn.“ (Klagelieder 3,17 u. 18) Gott ist so fremd, dass der Beter nicht einmal mehr auf ihn warten kann. Darin zeigt sich der Realismus des biblischen Gottesbildes. Wenn ich meine, eigentlich müsste Gott immer und wie selbstverständlich da sein, bin ich irritiert, wenn die Illusion zerbröckelt. „Es ist nur angebracht, sich schnell von dieser Naivität zu verabschieden!“, mag man zu sich sagen.
- Vor allem der Advent will das „Tor der Erwartung Gottes“ (vgl. Hosea 2,17) neu öffnen. Der Advent steht am Beginn des Kirchenjahres. Bevor sich der Blick auf Weihnachten ausrichtet, geht es darum, auf den richtigen Weg zu kommen, denn dies entscheidet sich mit den ersten Schritten. Mit dem Advent wird die Haltung des Wartens als die Grundhaltung des Glaubens eingeübt. Gottsuche ist keine vorübergehende Beschäftigung, weil Gott nicht gefunden wird wie der Schlüsselbund, die Brille oder eine Wohnung. „Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt (man kann auch übersetzen: nach mir forscht), lasse ich mich von euch finden.“ (Jeremia 29,13 f)
Das Warten verändert den Wartenden, und für den Wartenden ändert sich die Welt, denn er wird Akteur in einem „Wartesystem“. Er lebt in gespannter Aufmerksamkeit, wird achtsamer für die anderen wie für sich selbst, nimmt wahr, was vor sich geht, und auch, was sich nicht ändert, aber nicht so bleiben darf, weil es Leben hindert. Im Warten öffnet sich ein Raum, über den nicht ich verfüge. Im Gefängnis kann die Wartezeit auf verschiedenste Art genutzt oder eben auch ausgenutzt werden.
Prof. Georg Steins | Universität Osnabrück