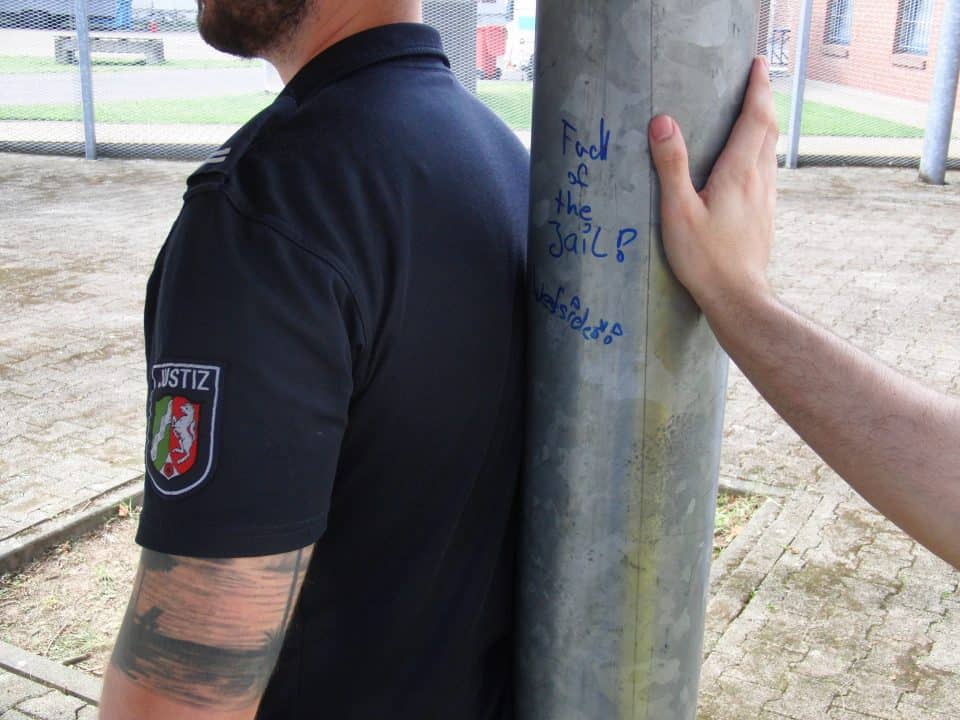Der deutsche Justizvollzug ist eine besondere Institution, deren Charakter maßgeblich von ihrer Funktion geprägt ist: So ist gemäß Paragraf § 2 StVollzG des Bundes das Vollzugsziel, dem alle weiteren Aufgaben bei- bzw. untergeordnet sind, die Resozialisierung der Inhaftierten. Menschen staatlich ihrer Freiheit zu berauben, wird gerechtfertigt mit dem Ziel, sie zu einem Leben in sozialer Verantwortung und ohne das Begehen weiterer Straftaten zu befähigen – so füllen die Justizvollzugsgesetze den Begriff der Resozialisierung.
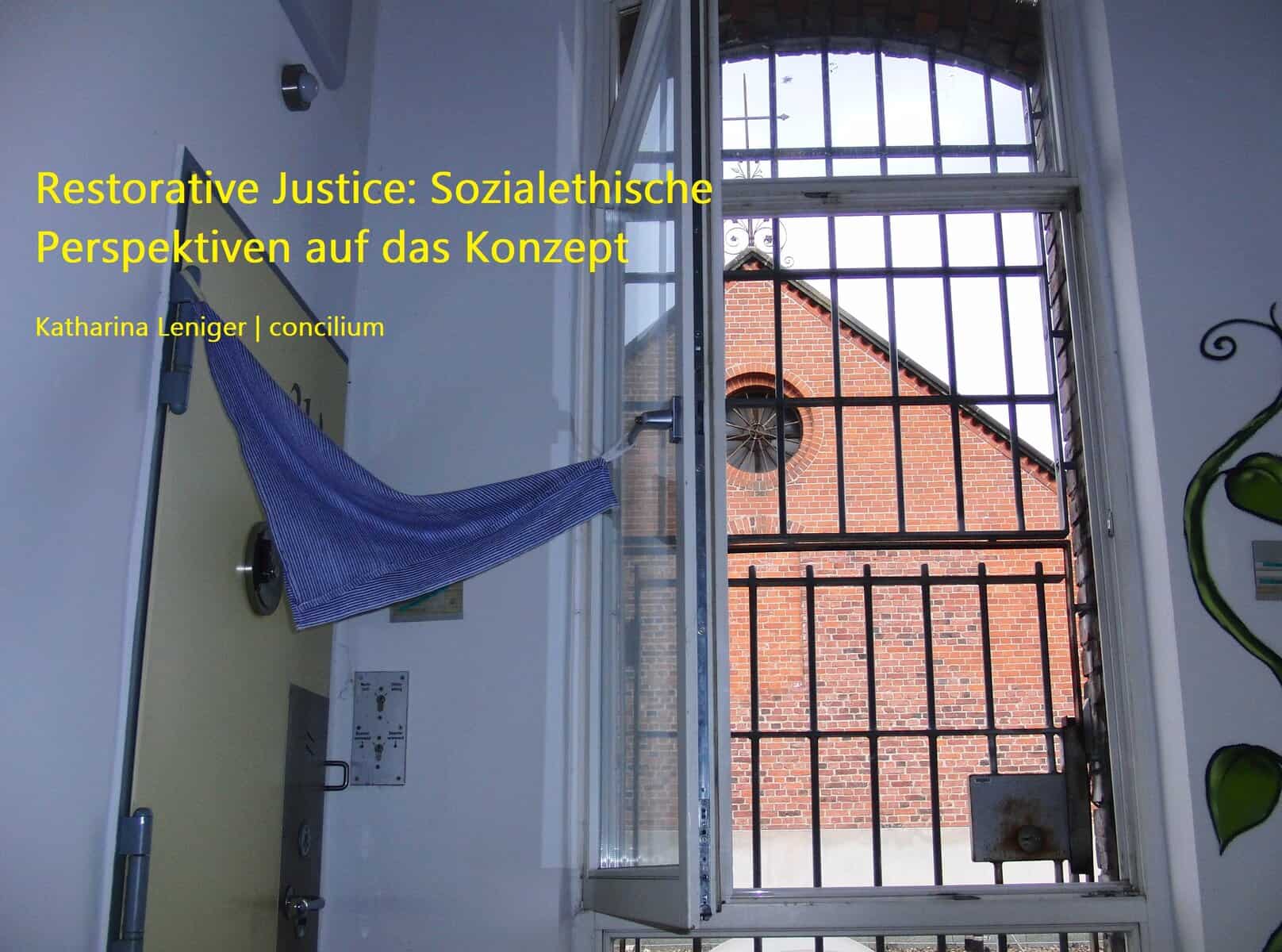
Was sich leicht in einem halben Satz niederschreiben lässt, ist dabei ein komplexes Unterfangen. Neben der praktischen Frage, ob dieses Ziel auch erreicht werden kann oder faktisch erreicht wird, ist auch die inhaltlich-moralische Dimension relevant: Ist ein solcher Umgang mit Straftaten und angesichts tiefgreifender Verletzungserfahrungen wirklich gerecht? Und für wen?
1. „Opferorientierung“ ¹ im Justizvollzug als Resozialisierungsinstrument?
Bleibt man zunächst bei dem ersten Fragenkomplex, dem nach der Wirksamkeit eines solchen staatlichen Strafens, wird man feststellen müssen, dass zumindest hohe Rückfallquoten eher daraufhinweisen, dass Gefängnisse ihrem Auftrag nicht hinreichend nachkommen. 2 Das Anliegen der Resozialisierung scheint durch den Justizvollzug nur unzureichend umgesetzt zu werden. Dass der deutsche Justizvollzug (und mit ihm die Politik) in gewisser Weise ratlos ist, wie man dem Resozialisierungsziel noch besser gerecht werden könnte, zeigt sich an vielfältigen Programmen und Projekten, die aus dem Boden sprießen. So ist neben besonderen Themenfeldern im Behandlungsprogramm, wie einer verstärkten Ein- und Rückbindung an die eigene Familie 3, auch eine verstärkte Einbeziehung der Betroffenen einer Tat zu beobachten. 4 Dies ist in verschiedenen Intensitäten und „Spielarten“ der Fall. Es gibt z. B. so genannte Opferempathieprogramme, die ohne komplexeren personellen und organisatorischen Aufwand versuchen, über die Einnahme der Perspektive der Betroffenen eine Veränderung im Handeln der Inhaftierten zu erzielen. Das sogenannte Betroffenenorientierte Arbeiten im Strafvollzug (BoAS), ein Konzept von Daniela Hirt, folgt dieser Richtung, bietet aber intensivere Auseinandersetzung durch die Konfrontation mit Personen, die ähnliche Straftaten erlebt haben. 5
Die vielleicht schärfste Form der Auseinandersetzung mit der Tat und den Betroffenen schafft der sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) im Justizvollzug, der zwischen den direkt betroffenen und tatverantwortlichen Personen erzielt werden soll. Diese lediglich projektweise umgesetzten Konzepte sind von ihren Grundlagen her nicht neu, der TOA wurde bereits in den 1990er-Jahren außerhalb und innerhalb des Vollzugs rechtlich verankert, wenn er auch nicht flächendeckend in der Haft umgesetzt wird. 6 Und dennoch ist an der Dichte der Auseinandersetzung und an den aktuellen Projekten innerhalb des Vollzugs erkennbar, dass diese Fragestellungen kaum an Brisanz verloren haben. Verbunden mag damit auch die Vorstellung sein, dass über die Einsicht in die Konsequenzen des eigenen Handelns intensiver eine moralische Beeinflussung der Inhaftierten möglich ist. Das konkrete Leid der Betroffenen vor Augen zu haben, würde demnach eine nachhaltigere Denkens- und Verhaltensänderung erzielen. Betrachtet man derartige Maßnahmen der interpersonalen Aufarbeitung (sozial-)ethisch, könnte man fragen, ob diese Formen auch gerechter sind, als die Inhaftierten isoliert von den Betroffenen und der sie umgebenden Gesellschaft zu „behandeln“ 7 – bei aller Vorsicht, was den Begriff der Gerechtigkeit betrifft. Was genau wäre dann jedoch das „Mehr“ der Gerechtigkeit, das durch solche Konzepte bereitgestellt wird? Was sind die blinden Flecken, die diese Konzepte beleuchten? Und welche ethischen Probleme und konkreten Herausforderungen ergeben sich in der Durchführung? Diesen Fragen soll dieser Beitrag nachgehen. 8
2. Restorative Justice als normatives Konzept
Die Aufarbeitung zwischen den Betroffenen und den Verantwortlichen von Gewalttaten – die meist auch strafrechtlich relevant sind, aber nicht sein müssen – wird meist unter dem Label der „Restorative Justice“ geführt. Allerdings ist der Begriff schillernd. Denn angesichts von Ungerechtigkeiten ist nahezu allen Gerechtigkeitskonzeptionen implizit, Gerechtigkeit „wiederherzustellen“ (engl. to restore). Es bleibt jedoch unklar, welche Form der Gerechtigkeit hier angestrebt wird – anders als das bspw. bei der Bedürfnis- oder Teilhabegerechtigkeit der Fall ist. Hinzukommt, dass „Justice“ neben der Wortbedeutung „Gerechtigkeit“ auch „Justiz“ heißen kann und diese Dimension in der deutschen Übersetzung nicht zum Tragen kommt. Auch wenn der Begriff aus diesen Gründen nicht unproblematisch ist, wird er als Terminus technicus hier weiterverwendet. Was sich auf der Wortebene zeigt, ist auch auf die inhaltliche zu übertragen. Denn unter Restorative Justice ist kein definiertes Programm zu verstehen, sondern vielmehr ein ganzes Bündel an Ideenhorizonten, Vorstellungen und normativen Konzepten. Um sich also in einer sozialethischen Hinsicht der Restorative Justice zu nähern, soll zunächst geklärt werden, woher der Begriff und die Wurzeln restorativer Praxis stammen, um anschließend normative Grundlinien herausarbeiten zu können.
Zugrunde liegt restorativen Verfahren die Annahme, dass ein Konflikt nur dann aufgearbeitet werden kann, wenn die daran beteiligten Personen und die Gemeinschaft, in der sie zusammenleben, an diesem Prozess mitwirken. Das Konzept hat seine Wurzeln in indigenen Gemeinschaften. 9 Im Falle einer zwischenmenschlichen Verletzung werden die Beteiligten – verantwortliche und betroffene Person(en) – mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft zusammengerufen. Das Ziel ist, den sozialen Frieden wiederherzustellen und die verletzte Beziehung aufzuarbeiten. Die Mitglieder der Gemeinschaft sollen einerseits die Verbundenheit und das unbedingte Eingebundensein in die sozialen Bezüge der direkt Beteiligten verdeutlichen und andererseits zeigen, dass die Gemeinschaft selbst durch derartige Konflikte und Taten Schaden nimmt 10 Insofern bezieht sich auch die wiederherstellende Dimension der Restorative Justice auf die Beziehung und das Beziehungsgefüge innerhalb einer sozialen Gruppe.

Häufig werden als Beispiel die sogenannten „Zirkel“ herangezogen, die in Kanada aktuell wiederbelebt werden: Die Beteiligten sitzen in einem Kreis und symbolisieren somit, dass sie als Gleichwertige alle ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft sind 11 Im Kreis wird unter der Moderation einer ausgewählten Person ein sogenannter Redestab herumgereicht, der ermöglicht, dass jede Person ungestört berichtet und erzählt, wie sie es für angemessen erachtet. Richtlinien und ein klarer zeitlicher Rahmen der Zirkel schaffen eine verbindliche Struktur, sodass alle geschützt und möglichst offen erzählen können. Durch die vielen Sichtweisen der Beteiligten wird so ein vertieftes Verständnis über das Geschehene erzielt und gleichzeitig die eigene Perspektive durch das Zuhören erweitert. Häufig werden als Ergebnis solcher Verfahren Absprachen getroffen, die das künftige Zusammenleben von Verantwortlichen und Betroffenen in ihrer jeweiligen Umgebung regeln. Ein Teil davon können Entschuldigungen, Wiedergutmachungsleistungen, Zusicherungen zu bestimmten Handlungsweisen oder Unterlassungen sein. Sie gelten nur dann als gerecht, wenn alle Beteiligten mit ihnen einverstanden sind und anzunehmen ist, dass eine erneute Verletzung ausgeschlossen werden kann.
An diesem ausgewählten Beispiel lassen sich einige wichtige Prinzipien ablesen, die für restorative Verfahren und die dahinterliegende Gerechtigkeitsvorstellung leitend sind. Ein wichtiges Prinzip ist die Kontextualität des zu transformierenden Zustandes, der jedoch nicht in dem gesteckten Rahmen verharrt. Als kontextuell verstehe ich die Prozesse, weil nur mit den konkreten Beteiligten, und zwar sämtlichen, ein ungerechter in einen gerechten Zustand überführt werden kann. Gleichzeitig wird deren Lebensumfeld und die relevante Bezugsgemeinschaft mit in diese Aufarbeitung einbezogen, also auch vorherige ungerechte und ungelöste Umstände mitberücksichtigt. Substanziell ausschlaggebend dafür, was als gerechter Zielzustand gelten kann, sind die Bedürfnisse der Beteiligten. 12 Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Verletzungen Bedürfnisse hervorrufen, die mit bestimmten Reaktionen beantwortet werden müssen. 13 Prozessual werden also alle Beteiligten als Gleiche behandelt und können sich als solche einbringen, hinsichtlich ihrer je individuellen Vorerfahrungen und Handlungsspielräume jedoch stellen sie ihre je persönliche Sichtweise dar und werden als Subjekte wahrgenommen. Das moralische Ungleichgewicht, das durch die Verletzung entstanden ist, die die betroffene von der verantwortlichen Person und beide von der Gemeinschaft entfernt, soll so wieder ausgeglichen werden.
Der Konflikt wird damit zurück in die Hände derer gelegt, die an ihm beteiligt sind oder wurden („Ownership“) 14 Restorative Prozesse schaffen insofern Möglichkeiten, dass Personen, die sich als ohnmächtig, verletzt, stigmatisiert wahrnehmen, in ihrer Agency anerkannt werden und diese wahrnehmen können. Das meint maßgeblich, dass die Prozesse von den Beteiligten inhaltlich und prozessual gestaltet werden. Es heißt aber auch, dass alle Parteien jederzeit, auch schon vor Beginn, die Zustimmung zu den Verfahren verweigern können. 15 Die Reaktionen auf einen Konflikt sollen in restorativen Verfahren auf die jeweilige Situation der Beteiligten passen und eine Verbindung zwischen der Verletzung und der Wiedergutmachung schaffen. Statt in einem schuldhaften Zustand zu verharren, wird dieser durch die Benennung konkreter Verantwortlichkeiten transformiert. 16 Die Konfrontation mit den Erzählungen der betroffenen Person(en) kann dazu anregen, das eigene Handeln nicht nur in einem anderen Licht zu sehen, sondern für zukünftige Situationen zu ändern. Dazu gehört maßgeblich eine emotionale Dimension, denn durch die Erzählung der Beteiligten wird ein vertieftes Verständnis über die konkrete persönliche Lage des Gegenübers erreicht. Eine wichtige Rolle der Gemeinschaftsmitglieder ist dementsprechend, die jeweiligen Erfahrungen und Erzählungen einzuordnen und Resonanzen mitzuteilen. Diese stellen auch für die betroffenen und verantwortlichen Personen wichtige Ressourcen zur (moralischen) Einordnung und zum späteren Umgang mit der Situation zur Verfügung 17
Immer wieder werden restorative Verfahren als heilend und versöhnend qualifiziert. Trotzdem ist Restorative Justice als Gerechtigkeitskonzept zu verstehen. Obwohl restorative Verfahren Verletzungen ins Zentrum der Bemühungen rücken, bleiben sie bei deren Heilung nicht stehen. Vielmehr zeigen sie, dass eine Aushandlung individueller bzw. intersubjektiver Gerechtigkeitsvorstellungen einen essenziellen Bestandteil der Aufarbeitung darstellen. Sie heben hervor, dass jeder Mensch verletzlich ist, doch deshalb nicht weniger handlungsfähig sein muss, sondern nur in seiner Bedürftigkeit angewiesen ist auf soziale Bezüge. Eine „umfassende“ Heilung kann sich insofern in vielen Fällen nur dann ereignen, wenn auch dem Bedürfnis nach einem gerechten Umgang begegnet wird. In restorativen Prozessen drückt sich diese inhaltliche Dimension auch im Verfahren aus, das geprägt ist von partizipativem Dialog, zwischenmenschlicher Begegnung und dem authentischen Erzählen subjektiver Erfahrungen. Die Beteiligten sind dabei nicht auf sich gestellt, sondern erfahren Begleitung und Unterstützung durch moderierende Personen und die sie umgebenden Mitglieder der Gemeinschaft. Sie führen im Idealfall zu einer Befähigung, die Konflikte selbstbestimmt und „ganzheitlich“ aufzuarbeiten und im Einklang zwischen innerer Verantwortlichkeit und äußerer Verantwortungsübernahme zu handeln. Indem restorative Verfahren den Fokus auf die persönlichen Beziehungen zwischen den Beteiligten und auf die soziale Verantwortung der Gemeinschaft legen, gehen sie über den Anspruch auf individuelle Heilung hinaus. Das wird deutlich im sehr hohen Anspruch solcher Verfahren, sozialen Frieden zu ermöglichen (oder wenigstens Situationen zu befrieden). 18

3. Restorative Justice im deutschen Justizvollzug – eine schöne neue Welt?
Mit dem erarbeiteten rudimentären Gerüst ist es nun möglich, restorative Verfahren auf ihre Anwendbarkeit im Justizvollzug hin zu untersuchen. Hierzu ist es sinnvoll und notwendig, Unterschiede und kritische Brüche zu benennen und zu analysieren, die in der Anwendung restorativer Prinzipien und Verfahrensformen auf ein Umfeld wie den Justizvollzug entstehen. Dass es auch innerhalb des Justizvollzugs unterschiedliche Verfahrensformen gibt, erschwert klare Aussagen, aber lässt auch erkennen, wo die Differenz zu den ursprünglichen Zielen und Anliegen größer wird.
Insofern der Justizvollzug dem Vollzugsziel der Resozialisierung verpflichtet ist, nimmt er Individuen in den Blick. Konkret sind das die Inhaftierten, die in strafrechtlicher Perspektive als die Schuldigen auf die Seite der tatverantwortlichen Personen zu rechnen sind. Schon während des Strafprozesses, also noch vor der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, kommt Gerichten die Funktion zu, den Konflikt auf einer von der persönlichen Involvierung befreiten Ebene zu verhandeln und das Strafmaß lediglich abhängig von Schuld zu verhängen. Damit soll verhindert werden, dass es durch Rache zu einer Ungleichbehandlung der Verantwortlichen kommt. Gerecht ist dann, alle in gleichem Maße Schuldigen gleich zu bestrafen, ohne spezifisches Ansehen der Person. Damit ist in die Behandlung der Individuen in Justizvollzugsanstalten auch immer eine gesellschaftliche Dimension eingewoben. Restorative Prozesse, die eine Annäherung der Konfliktbeteiligten anstreben und auf einen sozialen Frieden hinarbeiten, können in diese Bemühungen um Resozialisierung eingeordnet werden. Denn die Annäherung und Wiedergutmachung auf verschiedenen Ebenen kann bewirken, dass sowohl die Gefahr einer erneuten Straftat in diesem Bereich sinkt als auch, dass die Tatverantwortlichen „soziale Verantwortung“ übernehmen 19 Insofern ist verständlich, dass in vielen Justizvollzugsanstalten diese positiven Effekte genutzt werden sollen, auch wenn es kaum Untersuchungen zu diesen Zusammenhängen gibt.
Daneben sind allerdings auch zahlreiche Kritikpunkte zu beachten: Neben ganz praktischen Hindernissen sind es vor allem ethische Bedenken, die im Folgenden beleuchtet werden sollen. Die Justizvollzugsanstalt ist ein Ort, an dem ausschließlich die Tatverantwortlichen und deren persönliches Umfeld im Fokus der Tätigkeit stehen. Die Zeit der Inhaftierung nun zu nutzen, um auch die Perspektive und Belange der Betroffenen wahrzunehmen, mag sinnvoll scheinen. Allerdings läuft eine Hinwendung zu den Betroffenen Gefahr, übergriffig und instrumentalisierend zu werden. Zwar kann es auch das Bedürfnis der geschädigten Personen sein, eine Begegnung oder einen Ausgleich mit den Verantwortlichen zu erzielen. Gleichzeitig kann der Verdacht, dass Inhaftierte bei diesen Prozessen mitwirken, um persönliche Vorteile oder gar vorzeitige Haftentlassung zu erhalten, nur schwer entkräftet werden. Auch wenn ein Engagement sich nicht direkt auf den Vollzugsplan 20 auswirkt, ist doch damit zu rechnen, dass dies als positive Mitwirkung gewertet wird. Eine Instrumentalisierung solcher Prozesse zu Hafterleichterung oder –verkürzung kann von Seiten der Betroffenen als unaufrichtig gewertet werden und so zu weiteren Verletzungen führen.
Ein weiteres Problem stellt die Einbeziehung einer Repräsentanz der „Gemeinschaft“ dar, die in aktuellen gesellschaftlichen Bezügen nur sehr selten eindeutig zu definieren ist. Ein Gefängnis und das Umfeld der Beteiligten sind dem Kontext einer indigenen Gemeinschaft kaum anzugleichen. Es ist zu erwarten, dass durch die Einbeziehung von anderen gesellschaftlichen Akteuren weitere Interessen in das Verfahren hineingetragen werden. Gleichzeitig soll diese Gruppe auf den Prozess einen moralischen Einfluss nehmen und die Frage der Aufarbeitung mit der eigenen Perspektive begleiten. Einen weiteren problematischen Punkt stellt der Moment der Kontaktaufnahme dar. In den meisten Fällen gibt es keinerlei Kontakt zwischen den Beteiligten. Das heißt, dass insbesondere die betroffenen Personen zwar eine Auskunft über den Verbleib der tatverantwortlichen Person erhalten können, aber ebenso frei sind, keinerlei Kontakt oder Informationen zu wünschen. Möchte beispielsweise eine inhaftierte Person eine Begegnung mit der Person, die von ihr geschädigt wurde, ist damit in vielen Fällen ein Grenzübertritt verbunden. Schon mit der ersten Kontaktaufnahme kann eine erneute Verletzung und gar Retraumatisierung der betroffenen Person einhergehen, selbst wenn die Kontaktaufnahme über Dritte oder per Post stattfindet. 21
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Anspruch der „Versöhnung“, der oft mit Restorative Justice in Verbindung gebracht wird. Die berühmtesten Beispiele dafür sind vermutlich die so genannten „Truth- and Reconciliation Commissions“ in Südafrika in den 1990er-Jahren. Ähnlich wie das Ziel des sozialen Friedens ist auch Versöhnung ein äußerst wünschenswerter Zustand. Gleichzeitig ist der Anspruch an Betroffene, sich mit der verantwortlichen Person zu versöhnen, für diese häufig unvorstellbar. Er kann sogar als moralischer Druck wahrgenommen werden etwa, wenn Betroffene nicht einwilligen, den Verantwortlichen zu begegnen. Mit der überhöhten (gesellschaftlichen) Wunschvorstellung, dass es in Zukunft ein versöhntes, friedliches Zusammenleben der Beteiligten geben soll, werden notwendig freiwillige Prozesse mit Zwang (und Schuld im Fall des „Scheiterns“) belegt. Damit geschieht eine Verlagerung der Verantwortung von der Seite der Tatverantwortlichen auf die Seite der Betroffenen. Der überhöhte Anspruch auf Versöhnung ist in diesen Fällen kontraproduktiv und läuft Gefahr, die Beteiligten zu überfordern.
Autorin
Katharina Leniger war von 2018 bis 2024 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Christliche Sozialethik der Julius-Maximilian-Universität Würzburg. In ihrer Dissertation (erscheint 2025) erarbeitet sie sozialethische Reflexionen zu Restorative Justice im (deutschen) Justizvollzug.
Sie ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Ethik der Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. Seit September 2024 außerdem Leiterin des Referats Geistliches Leben, Personalseelsorge (Bistum Würzburg).
Universität Würzburg
Professur für Christliche Sozialethik
Bibrastraße 14
D 97070 Würzburg
katharina.leniger(at)gmx.de
Neben diese inhaltlich-moralischen Kritikpunkte treten auch praktische Probleme, die in ihrer Folge Auswirkungen auf die Qualität und die Wirksamkeit der Verfahren haben. Am gewichtigsten ist die generelle Ressourcenknappheit im Justizvollzug und in der Justiz ganz allgemein. Es fehlt an vielem, vor allem aber an gut ausgebildetem Fachpersonal. Insbesondere in den psychologischen und sozialen Fachdiensten sind schlicht kaum Spielräume vorhanden, um aufwendige Verfahren zu entwickeln und durchzuführen. „Echte“ restorative Verfahren, die die direkt Beteiligten und die Gemeinschaft repräsentierende Personen zusammenholen und eine adäquate Vor- und Nachbereitung beinhalten, sind sehr zeit- und damit personal- und kostenaufwendig. Es ist zu befürchten, dass die mögliche Verlagerung auf restorative Verfahren in großem Maße dazu beiträgt, dass die psychosoziale Versorgung der anderen Inhaftierten zurückgefahren würde. Insofern ist die Verhältnismäßigkeit solcher umfangreichen Verfahren zu hinterfragen. Eine gezielte Aufstockung der Ressourcen wäre unerlässlich, wollte man qualitätvolle restorative Verfahren im Justizvollzug etablieren.
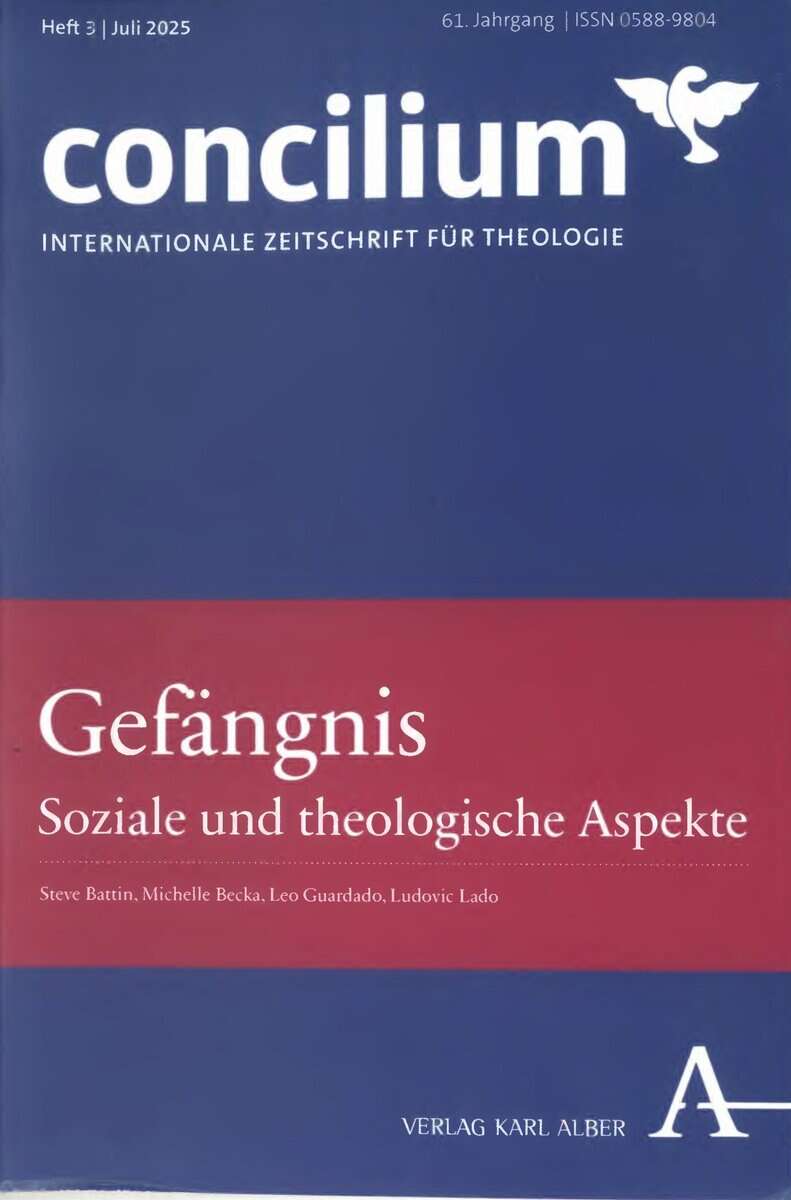 Zusammenfassend ist es ein wichtiges Anliegen, die blinden Flecken der Justiz wie die Aufarbeitung von Gewalttaten mit allen Beteiligten aufzudecken. Die Tatsache, dass die Bedürfnisse und konkreten Verletzungserfahrungen kaum den weiteren Umgang mit der Tat und den Personen prägen, stellt einen als ungerecht empfundenen Zustand dar. Insofern reagieren restorative Verfahren auf konkrete Ungerechtigkeit. Sie sind mehr als wohltuende Begegnungen, auch weil sie konkrete Handlungen und Haltungen der Beteiligten erfordern. Sie konkret im deutschen Justizvollzug umzusetzen, bedeutet jedoch die Bereitstellung umfangreicher personeller und monetärer Ressourcen und darüber hinaus die Bereitschaft, sich auch kritisch mit den ethischen Problemfeldern solcher Verfahren zu beschäftigen. Nur dann können restorative Verfahren im Vollzug mehr werden als ein neuerlicher Versuch, einer in vielerlei Hinsicht schwierigen Institution mit vielen Problemen einen etwas menschlicheren Anstrich zu verleihen.
Zusammenfassend ist es ein wichtiges Anliegen, die blinden Flecken der Justiz wie die Aufarbeitung von Gewalttaten mit allen Beteiligten aufzudecken. Die Tatsache, dass die Bedürfnisse und konkreten Verletzungserfahrungen kaum den weiteren Umgang mit der Tat und den Personen prägen, stellt einen als ungerecht empfundenen Zustand dar. Insofern reagieren restorative Verfahren auf konkrete Ungerechtigkeit. Sie sind mehr als wohltuende Begegnungen, auch weil sie konkrete Handlungen und Haltungen der Beteiligten erfordern. Sie konkret im deutschen Justizvollzug umzusetzen, bedeutet jedoch die Bereitstellung umfangreicher personeller und monetärer Ressourcen und darüber hinaus die Bereitschaft, sich auch kritisch mit den ethischen Problemfeldern solcher Verfahren zu beschäftigen. Nur dann können restorative Verfahren im Vollzug mehr werden als ein neuerlicher Versuch, einer in vielerlei Hinsicht schwierigen Institution mit vielen Problemen einen etwas menschlicheren Anstrich zu verleihen.
Katharina Leniger | concilium Heft 3, Juli 2025, 61. Jahrgang
Mit freundlicher Genehmigung: Verlag Karl Alber
Anmerkungen
1 lm folgenden werden die Begriffe »Täter« und »Opfer« vermieden, denn sie stellen in vielerlei Hinsicht Stigmatisierungen und Objektivierungen bereit, die den Personen verunmöglichen, ihre Handlungsfähigkeit wiederzuerlangen und mit den eigenen Erfahrungen umzugehen. Stattdessen werden diese als Betroffene und Verantwortliche bezeichnet, was den Fokus auf die erlittenen Erfahrungen legt, aber die Perspektive auf die Zukunft hin offenlässt.
2 Für differenziertere Einsichten vgl. Bundesministerium der Justiz, Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen: Eine bundesweite Rückfalluntersuchung, 2013 bis 2016 und 2004 bis 2016, Berlin 2020, verfügbar unter… [abgerufen am 27.10.2024].
3 In Nordrhein-Westfalen wird der so genannte „Familiensensible Justizvollzug“ forciert, vgl. Pressemitteilung der Landesregierung NRW: „Justizminister Dr. Limbach stellt landesweites Konzept einer familiensensiblen Vollzugsgestaltung in Nordrhein-Westfalen vor“, 12.04.2024, verfügbar unter… [abgerufen am 27.10.2024].
4 Der Behandlungs- wird dem sogenannten Verwahrvollzug häufig gegenübergestellt und positiver bewertet, weil mit den Inhaftierten gearbeitet wird. Auf die ethischen Schwierigkeiten dabei kann hier nicht weiter eingegangen werden.
5 Vgl. Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzuges, Justiznewsletter 20 (37) 2023, 1-9, Download… [abgerufen am 27.10.2024].
6 Einführend vgl. Frank Winter, Täter-Opfer-Ausgleich und Restorative Justice, in: Heinz Cornel u. a. (Hg.), Resozialisierung. Handbuch, Baden-Baden, 2018, 479-502, sowie die Seiten des TOA-Servicebüros, verfügbar unter… [abgerufen am 27.10.2024].
7 In Deutschland wird ein auf Resozialisierung zielender Justizvollzug häufig mit dem umstrittenen Begriff „Behandlungsvollzug“ bezeichnet.
8 Umfassender wurden diese Fragestellungen in der Dissertationsschrift der Autorin dargestellt, die zum Veröffentlichungszeitpunkt des vorliegenden Artikels noch nicht gedruckt vorliegt.
9 Hagemann identifiziert neben diesen indigenen Wurzeln auch „westliche Wurzeln“, die er als teilweise unabhängig voneinander beschreibt, vgl. Otmar Hagemann, Restorative Justice. Heilung, Transformation, Gerechtigkeit und sozialer Frieden (Restorative Justice. Täter-Opfer-Ausgleich & Konfliktregelung 1), Köln 2023, 13.
10 vgl. Thomas Trenczek, Restorative Justice – (strafrechtliche) Konflikte und ihre Regelung, in: Arbeitskreis der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen Kriminologie/Straffälligenhilfe in der Sozialen Arbeit (Hg.), Kriminologie und soziale Arbeit. Ein Lehrbuch, Weinheim/Basel 2014, 193-210, hier 196.
11 Vgl. Isabel Thoß/Elmar G. M. Weitekamp, Friedenszirkel, ein wiederentdecktes Verfahren zur Konfliktbewältigung. Eine im englischen Sprachraum als „Peacemaking-Circle“ bezeichnete Methode der Restorative Justice, in: Ricarda Lummer/Mario Nahrwold/Björ Süß (Hg.) Restorative Justice. A Victim Perspective and Issues of Co-operation (Schriftenreihe Soziale Strafrechtspflege 2), Kiel 2012, 88-1I6, hier 90.
12 Die meisten theoretischen Konzepte arbeiten mit dem Begriff der Bedürfnisse (needs), bspw. vgl. Golan Luzon, Restorative justice and normative responsibility, in: Restorative Justice: An international Journal (RJIJ) 4 (2016), 27-40, hier 34.
13 Vgl. Friedrich Schwenger, Restorative justice. Veränderung durch Versöhnung, Zürich 2022, 21.
14 Vgl. Gerry Johnstone, How, And In What Terms, Should Restorative Justice Be Conceived?, in: Howard Zehr/Barb Toews (Hg.), Critical issues in restorative justice, Monsey/New York 2004, 5-15, hier 12.
15 Vgl. Otmar Hagemann, Restorative Justice und Resozialisierung – Abgrenzung und Gemeinsamkeiten, in: Bernd Maelicke/Christopher Wein (Hg.), Resozialisierung und Systemischer Wandel, Baden-Baden 2020, 151-179, hier 158.
16 Vgl. Ann-Sophie Maluck/Nina Niesen, Justice als Empowerment, in: TOA-Magazin (2019), 48-50, hier 48.
17 Dass moralische Beeinflussung und Beschämung selbst manipulativ und gewaltsam werden können, sei hier nur am Rande bemerkt. Das Konzept der „Reintegrative Shame“ wurde von Braithwaite in einer eigenen Publikation ausgefaltet und ist kritikwürdig, vgl. John Braithwaite, Crime, shame, and reintegration, Cambridge 1989.
18 Vgl. Lode Walgrave, Has Restorative Justice Appropriately Responded To Retribution Theory and Impulses? in: Zehr/Toews, Critical issues, 47-60, hier 56.
19 Vgl. Maluck/Niesen, Justice als Empowerment, 49.
20 In diesem werden die verschiedenen Maßnahmen, Betätigungen und Ausbildungen festgesetzt, die den Inhaftierten ermöglicht und gestattet werden, um das Ziel der Resozialisierung bestmöglich zu erreichen. Die Inhaftierten sollen daran mitwirken. Auch die Unterbringungsart sowie die so genannten Lockerungen sind Teil dieses Plans. In Bayern ist der Vollzugsplan in Art. 161 BayStVollzG geregelt.
21 Zur Thematik der Retraumatisierung unter vielen Publikationen bspw. vgl. Wolfgang Woller, Trauma und Persönlichkeitsstörungen. Psychodynamisch-integrative Therapie, Stuttgart/New York 2006, 186.