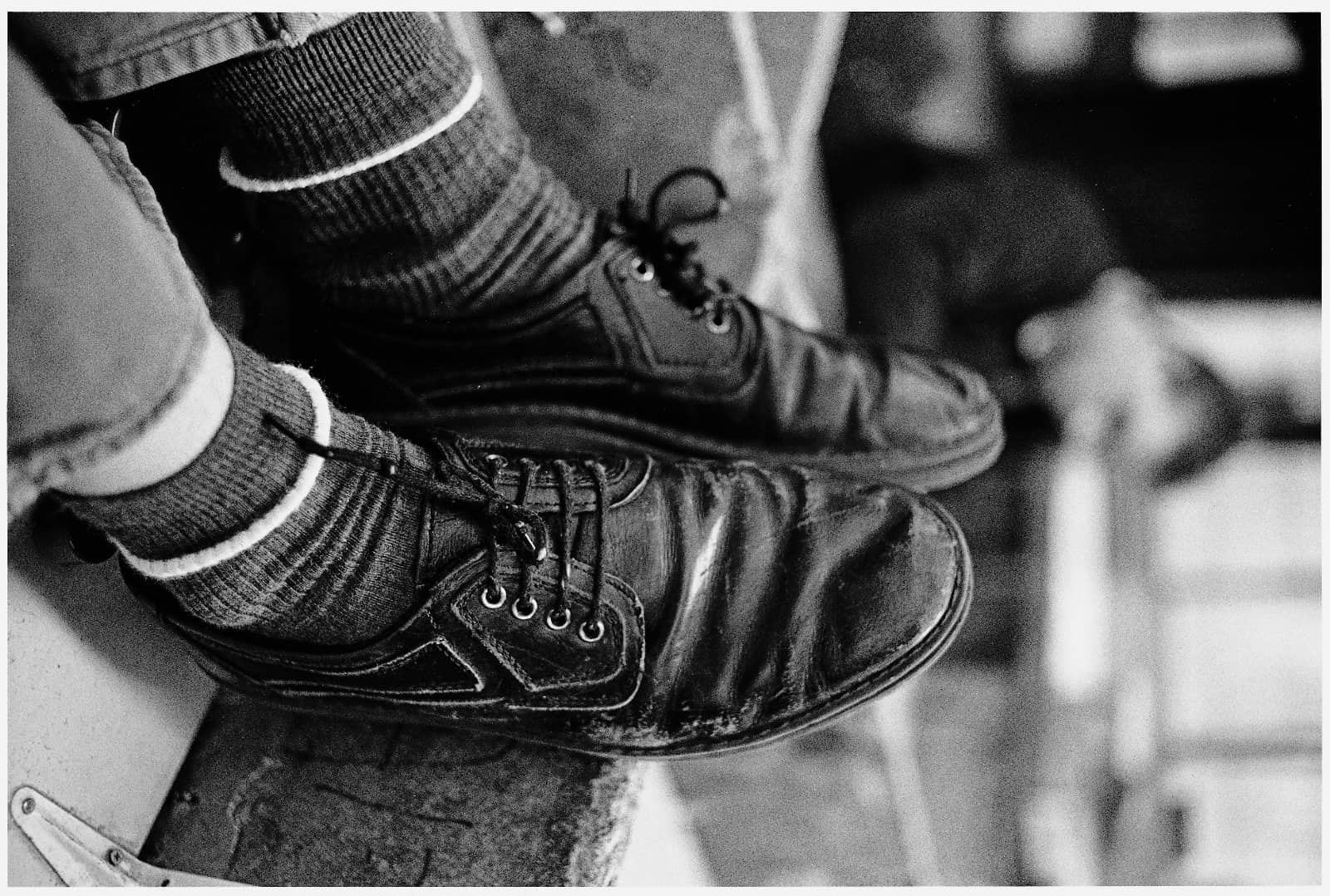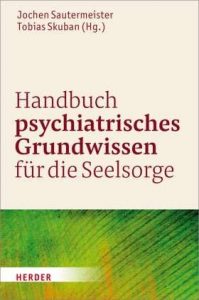Psychische Erkrankungen, seelische Nöte und existenzielle Krisen stellen persönliche und zwischenmenschliche Belastungen dar, in denen Menschen tiefgreifend verunsichert und sich selbst fremd werden können und in denen vertraute Orientierungsmuster und lebensweltliche, sinnstiftende Einbettungen spürbar irritiert werden. In solchen Erfahrungen kommen in besonderer Weise unsere menschliche Vulnerabilität und Zerbrechlichkeit zum Vorschein. Seelsorge und Psychiatrie richten sich an Menschen, vor allem an verletzte Menschen, an Menschen in einer Krise.

So sehen sich SeelsorgerInnen und ebenso wie PsychotherapeutInnen in ihrem Alltag mit zahlreichen – sehr unterschiedlichen – (zwischen-) menschlichen Situationen und Konstellationen konfrontiert, die eine große professionelle und existenzielle Herausforderung darstellen können und in denen sie als Begleiter, Zuhörer und Ratgeber angesprochen werden. Deutliche Unterschiede zwischen diesen verschiedenen helfenden Zugangsweisen bestehen im jeweiligen Deutungsrahmen und in weltanschaulichen Voraussetzungen, die früher immer wieder Gegenstand teils polemischer Auseinandersetzungen waren.
Wenngleich bis vor einigen Jahrzehnten auf beiden Seiten eine eher kritisch-ablehnende Haltung vorherrschte, sind seit etwa 50 Jahren beiderseits Ansätze und Initiativen zu beobachten, wechselseitig hilfreiche Leistungen anzuerkennen und jeweils für die eigene Praxis fruchtbar zu machen. Während noch Sigmund Freud bemerkte, dass der „Verlust religiöser Illusionen […] durch Wissenschaft und Technik“ kompensiert werden könne, begegnen wir heute auf Seiten der Psychotherapie einer großen Anzahl spirituell „fundierter“ Ansätze und Interventionen, etwa im Kontext achtsamkeitsbasierter Verfahren.
Auch die Kirchen haben sich psychologischen Erkenntnissen geöffnet: So sind mittlerweile in der kirchlich-seelsorgerischen Praxis zahlreiche Angebote etabliert, die sich im Berührungsfeld zu Psychiatrie, Psychotherapie und psychologischer Beratung bewegen. Zu nennen sind hier insbesondere die Gefängnisseelsorge, Beratungsstellen, Telefon- Krankenhausseelsorge, Kinder- und Jugendpastoral, Schulpastoral und die zahlreichen Angebote von Caritas und Diakonie u.a.m. Pastoral- und Moralpsychologie als Praxiswissenschaften im Schnittfeld von Theologie und Psychologie widmen sich den entsprechenden Fragestellungen. Sowohl PsychiaterInnen als auch SeelsorgerInnen begegnen Menschen in Krisen. Angesichts der gegenwärtigen psychiatrischen Versorgungslage und einer problematischen gesundheitspolitischen Situation, die dazu führt, dass in Deutschland die Wartezeiten für einen Termin und vor allem für eine längerfristige, kassenärztlich finanzierte Psychotherapie mehrere Monate betragen können, sind auch Seelsorgende als Ansprechpersonen gefragt.
Gerade innerhalb der unterschiedlichen, oftmals niederschwelligen Gesprächsangebote geraten sie immer wieder in Kontakt mit Menschen, die schwerwiegende persönliche Nöte erleben. Wenn man bedenkt, dass etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung einmal im Leben von einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung betroffen ist, wird klar, dass bei Menschen, die bei SeelsorgerInnen Hilfe suchen, durchaus und nicht selten auch ernst zu nehmende psychische Leiden und Beschwerden vorliegen, die einer medizinisch-therapeutischen Behandlung bedürfen. In solchen Situationen stehen Seelsorgende vor wichtigen Aufgaben:
- Zum einen sollen sie dafür sensibel sein, ob eine psychische Erkrankung vorliegen oder im Hintergrund stehen könnte; zum anderen sollen sie über die entsprechenden Unterstützungsangebote informiert sein, die für die ratsuchende Person hilfreich sein könnten.
- Daneben kann es auch vorkommen, dass sich SeelsorgerInnen in kritischen Situationen wiederfinden, die ohne entsprechendes Fachwissen nur schwer zu lösen sind. Wie soll sich beispielsweise ein/e SeelsorgerIn verhalten, wenn innerhalb eines Gespräches suizidale Gedanken geäußert werden?
- Was kann ein/e SeelsorgerIn tun, wenn eine Mutter berichtet, ihre Tochter esse seit vielen Monaten kaum noch, sei stark untergewichtig und empfinde sich immer noch als zu dick? Was könnte eine angemessene Reaktion darauf sein, wenn einem in einem seelsorgerlichen Gespräch berichtet wird, der andere halte sich für von Gott erwählt und er höre Jesu Stimme?
- Wie sollte man agieren, wenn ein Kind in der Jugendgruppe andeutet, dass es sich zu Hause unwohl fühlt, weil eines der beiden Elternteile viel Alkohol trinkt und aggressiv wird?
- Wie kann man weiterhelfen, wenn ein Gemeindemitglied das Gespräch sucht und berichtet, ständig zu weinen, nicht mehr aufhören zu können zu grübeln, nicht mehr aus dem Bett zu kommen und die sozialen Kontakte mehr oder minder allesamt abgebrochen zu haben?
Der Kontakt zwischen einem SeelsorgerIn und einer Hilfe suchenden Person zeichnet sich oftmals dadurch aus, dass ein gutes Vertrauensverhältnis besteht. Der SeelsorgerIn hat möglicherweise schon über viele Jahre Kontakt zur Familie, das Enkelkind getauft oder den Kindergottesdienst organisiert. In der Kategorialseelsorge sind Seelsorgernde oft der/die „gute Andere“, die Zeit haben und denen man sich öffnen kann. Dabei realisieren sie persönliche und religiöse Beziehungsqualitäten, die sich in einem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Gespräch so erst einmal nicht unbedingt wiederfinden (und wegen der angestrebten therapeutischen Professionalität und weltanschaulichen Neutralität auch nicht finden sollten).
Psychiatrisch-psychotherapeutisches Hilfesystem
In einem vertrauensvollen Kontakt mit einer SeelsorgerIn werden mit unter Dinge zur Sprache gebracht, die man anderen gegenüber sich sonst nicht zu sagen traut, die schambesetzt sind oder die bedrohlich wirken. Hat der Seelsorgende erkannt, dass eine psychische Störung vorliegen könnte, ist es angezeigt, medizinische und psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe zu empfehlen. Wenn das Erkennen und Ansprechen des leib-seelischen Leidens, der möglichen Erkrankung und ggf. der Verweis auf geeignete Anlaufstellen dazu führt, dass sich die ratsuchende Person an entsprechende Einrichtungen wendet, kann sie rasch angemessene Hilfe erhalten. Das Aufsuchen des psychiatrisch-psychotherapeutischen Hilfesystems kann jedoch – aus unterschiedlichen Gründen –auch eine hohe Hürde darstellen. Menschen könnten sich „psychiatrisiert“, nicht ausreichend ernst genommen oder aufgrund unangemessener Vorurteile und Stigmatisierungstendenzen sogar abgewertet fühlen.
Gerade in solchen Situationen bedarf es dann auf Seiten der Seelsorgenden neben ausreichendem Einfühlungsvermögen und pastoralem Gespür auch eines gewissen Ausmaßes an Fachwissen über psychische Erkrankungen und einer Vorstellung davon, wie man angemessen mit Menschen umgehen kann, die an einer bestimmten psychischen Erkrankung leiden. Dies in Verbindungmit dem gläubigen Vertrauen und der christlichen Überzeugung, dass alle Menschen – unabhängig von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Krisen jeglicher Art – von Gott gewollt und von seiner unbedingten Liebe und Sympathie getragen sind, in konkreten Begegnungen erfahrbar zu machen, können wertvolle und heilsame Impulse sein.
SeelsorgerInnen keine „Psychiater light“
Mit diesem Handbuch soll ein differenzierter und verständlicher Überblick über das Fachgebiet für psychiatrisch-psychotherapeutische „Laien“ in professionellen und ehrenamtlichen Seelsorgekontexten gegeben werden. Dabei ist es keineswegs die Absicht des Bandes, die SeelsorgerInnen zu „Psychiatern light“ zu machen. Das wäre fachlich nicht zu verantworten. Vielmehr geht es darum, das notwendige Basiswissen zu vermitteln, um mit psychiatrisch herausfordernden Situationen umgehen zu können, die einem in der Seelsorge begegnen können. Hierzu sollen im ersten Teil ausgewählte theologische und pastorale Fragestellungen diskutiert und Perspektiven beleuchtet werden, bevor ein allgemeines, störungsunspezifisches psychiatrisches und praktisches Grundlagen- und Hintergrundwissen dargestellt wird.
Im zweiten, speziellen Teil werden gängige psychische Erkrankungen und spezifische Herausforderungen behandelt, mit denen man in der Seelsorge konfrontiert sein kann. Hierzu werden nach einer kurzen Skizze des Erscheinungsbilds der einzelnen Krankheitsbilder Symptomatik, Diagnostik und ausgewählte Erklärungsansätze skizziert. Ausblicke auf psychotherapeutische Interventionen und Hinweise für die pastorale Praxis wollen Perspektiven eröffnen. Literaturtipps zur Einführung und Vertiefung dienen der weiteren Information. Merkkästen zu Wissenswertem sollen den schnellen Zugriff erleichtern, ohne damit die Lektüre der einzelnen Beiträge ersetzen zu wollen.
Das vorliegende Handbuch möchte für die Not psychischer Erkrankungen und Krisen sensibilisieren, darüber informieren und hilfreiche Handlungsorientierung zur Verfügung stellen. Es will dazu beitragen, das Erkennen einer möglicherweise vorliegenden psychischen Erkrankung zu erleichtern. Zugleich will es aber auch damit verbundene pastorale Herausforderungen theologisch reflektieren.
Quelle: Einleitungstext des Handbuches