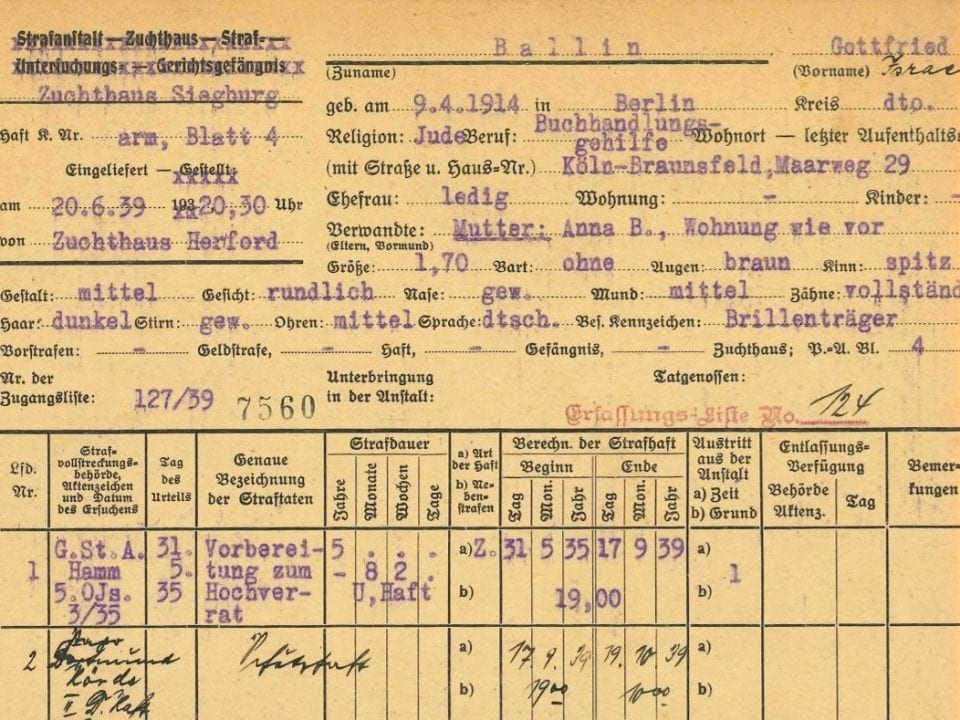Dieser Beitrag beschreibt das Bemühen der katholischen Kirche, in der 40-jährigen kommunistischen Diktatur im Ostteil Deutschlands, ein Minimum an Seelsorge in den Strafvollzugsanstalten zu ermöglichen. Bis zur Friedlichen Revolution 1989/90 wurde dies durch den sozialistischen Staat massiv eingeschränkt. Nur sehr wenigen Priestern war es in der DDR erlaubt, allenfalls einmal monatlich einen Gottesdienst zu halten. Da aber sowohl in der Verfassung der DDR als auch im Strafvollzugsgesetz religiöse Betätigung formal erlaubt war, wurde dies zum Konfliktfeld zwischen Staat und Kirche. Es geht damit am Beispiel der Gefängnisseelsorge auch um die Frage der Gewährleistung von Religionsfreiheit in der DDR.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die katholische Kirche bestrebt, wieder ungehinderten Zugang zu den Gefängnissen zu erhalten, der während des Krieges nur eingeschränkt möglich war. Im Ostteil Deutschlands, der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), herrschten hierfür theoretisch sogar gute Ausgangsbedingungen, denn in der neu geschaffenen Deutschen Justizverwaltung (DJV) – dem Vorläufer des späteren DDR-Justizministeriums – wurde mit Harald Poelchau ein ehemaliger evangelischer Gefängnisseelsorger für den Neuaufbau des Gefängniswesens zuständig. Poelchau hatte sich bereits in der Weimarer Republik in einer Bewegung zur Reform des Strafvollzugs engagiert, in der der Erziehungs- und Resozialisierungsgedanke erstmals in den Blickpunkt rückte. Während des Nationalsozialismus schloss er sich dem „Kreisauer Kreis“ im Widerstand gegen Hitler an. Als viele aus diesem Kreis verhaftet wurden, begleitete er sie als Gefängnisseelsorger in Berlin-Plötzensee bis zur Hinrichtung.
In Abstimmung mit der evangelischen Landeskirche erarbeitete Poelchau 1946 eine Dienstanweisung, die die Gefängnisseelsorge regeln und garantieren sollte. Vor der am 7. Oktober 1949 erfolgten Gründung der DDR lag die gesetzgeberische Gewalt jedoch bei der Sowjetischen Militäradministration und alle Gesetze und Verordnungen von deutschen Behörden mussten zur Genehmigung vorgelegt werden. Die sowjetische Besatzungsmacht war mit diesem Entwurf jedoch überhaupt nicht einverstanden und legte stattdessen deutlich schärfere Regeln für die Gefängnisseelsorge fest. Predigten mit politischen Inhalten wurden streng verboten, seelsorgliche Gespräche unter vier Augen nur mit Genehmigung des Anstaltsleiters gestattet und die bisherige Praxis, dass Priester bei ihren Besuchen auch religiöse und erbauliche Werke den Gefangenen zum Lesen mitbringen konnten, war nicht mehr erlaubt. Bücher und Schriften durften ausdrücklich nur noch durch den Anstaltsbibliothekar ausgegeben werden. Am problematischsten sollte sich aber die Regelung der „Wunschseelsorge“ erweisen. Die besagte, dass die Initiative für eine religiöse Betreuung von den Gefangenen ausgehen musste. Ihr erklärter Wunsch nach Seelsorge wurde Bedingung. Der Gefängnisseelsorger sollte somit nicht mehr die Namen der Häftlinge seiner Konfession erhalten, um sie von sich aus aufzusuchen oder zum Gottesdienst einzuladen, ein Umstand, der vor allem dann von Relevanz war, wenn die Inhaftierten gar nicht wussten, dass es eine Möglichkeit der seelsorglichen Betreuung gab. In der Praxis hatten Neuzugänge dadurch das Nachsehen. Auch erhielten die Inhaftierten durch das Anstaltspersonal nur selten die Information, dass der Wunsch nach seelsorglicher Betreuung durch einen Geistlichen offiziell, meist durch ein schriftliches Gesuch, zu stellen war.
Bis zur Gründung des ostdeutschen Teilstaats nahmen die Schwierigkeiten weiter zu. Zum einen wurde nach sowjetischem Vorbild ab 1948 damit begonnen, den Strafvollzug aus dem Bereich der Justiz herauszulösen und dem Innenressort zuzuordnen, zum anderen verlor die Justizverwaltung zunehmend diejenigen Mitarbeitenden, die einem Reformvollzug aufgeschlossen gegenüberstanden und die sich in diesem Zusammenhang für eine Gefängnisseelsorge einsetzten. Am 31. März 1949 schied mit Harald Poelchau deren stärkster Verfechter aus der DJV aus und floh in den Westen. Bis zum Juli 1952 war die Übernahme der Gefängnisse durch die „Deutsche Volkspolizei“ (DVP) abgeschlossen. Der Hauptgrund für den unternommenen Ressortwechsel resultierte aus einer ausdrücklichen Ablehnung der Besatzungsmacht und der SED-Spitze an einen „humanen Strafvollzug“, den sie für die Inhaftierung von vermeintlichen Gegnern für völlig ungeeignet hielten.

Ein Gefängniswagen (Barkas B1000) des Stasi-Gefängnis von der DDR Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.
Die Gefängnisseelsorge in den Anfangsjahren der DDR
In den von der sowjetischen Besatzungsmacht unterhaltenen „Speziallagern“ war von 1945 bis zu deren Auflösung Anfang 1950 keine Seelsorge möglich. Einzig zu Weihnachten 1949 – und damit erst nach der Gründung des ostdeutschen Teilstaats – konnten in Sachsenhausen, Bautzen und Buchenwald katholische Weihnachtsgottesdienste gefeiert werden. Als Bischof Heinrich Wienken sich am 24. März 1950 an das Ministerium des Inneren (MdI) wandte und eine Gottesdiensterlaubnis in den übernommenen Haftanstalten erbat, verwies er auch auf die von den Sowjets genehmigten Gottesdienste in den Sonderlagern. Die Hoffnung, dass die DDR-Regierung dem nicht nachstehen würde, zumal die Evangelische Kirche durchaus Gottesdienste abhalten durfte, sollte sich zunächst aber nicht erfüllen.
Wienken leitete in Berlin seit 1937 das sogenannte „Commissariat der Fuldaer Bischofskonferenz“, ein Verbindungsbüro zu den staatlichen Stellen. Diese Bezeichnung war auch auf seinem Briefbogen abgedruckt. Doch stand damit eine westdeutsche Stadt im Namen dieser Institution, so dass die VP-Offiziere deren Zuständigkeit auf dem Gebiet der DDR nicht anerkannten. Es bedurfte eines energischen Einsatzes des stellvertretenden Ministerpräsidenten Otto Nuschke (CDU), der damals innerhalb der DDR-Regierung die Hauptabteilung „Verbindung zu den Kirchen“ verantwortete, damit sich eine Tür für Verhandlungen überhaupt öffnen konnte. Zu Pfingsten 1951 konnte schliesslich erstmals in den vom MdI übernommenen Haftanstalten ein katholischer Gottesdienst gefeiert werden, die „Ohrenbeichte“ aber wurde ausdrücklich verboten. Erst 1952 sollte es zu kontinuierlichen katholischen Gottesdiensten kommen, nachdem im Zentralkomitee der SED entschieden wurde, dass eine regelmässige Seelsorge zu gestatten sei.
Die Vorstellungen der führenden Partei gingen jedoch noch weiter. Jeder Geistliche galt als ein potentielles Sicherheitsrisiko, weil sie möglicherweise die Gefängnisinsassen gegen den sozialistischen Staat hätten aufwiegeln können. Ein erster Schritt dagegen war, sogenannte „fortschrittliche“ Pfarrer – also solche, die dem Staat gegenüber aufgeschlossen waren – direkt als Zivilangestellte der Volkspolizei einzustellen. Insgesamt wurden drei evangelische Geistliche in den Staatsdienst geholt: Im Sommer 1950 Hans-Joachim Mund sowie im Januar 1953 Heinz Bluhm und Eckart Giebeler. Mund zog jedoch Ende der 1950er Jahre das Misstrauen der Sicherheitsorgane auf sich und floh vor einer möglichen Verhaftung im Januar 1959 nach West-Berlin. Bluhm erkrankte Mitte der 1960er Jahre, so dass ab November 1966 bis zum Ende der DDR Eckart Giebeler einziger hauptamtlicher Gefängnisseelsorger war. Er bezog jedoch doppeltes Gehalt, denn bis zum Herbst 1989 war er zusätzlich als Inoffizieller Mitarbeiter (IM „Roland“) für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) tätig und bezog dafür entsprechende Vergütungen. Giebeler war absolut linientreu. Selbst am Tag nach dem Fall der Berliner Mauer signalisierte er der Stasi weiterhin seine Treue und versprach seinem Führungsoffizier, „ohne Vorbehalte […] auch unter den aktuellen Lagebedingungen mit dem MfS zusammenzuarbeiten.“ Im Zentralkomitee der SED wurden 1952 sogar Überlegungen angestellt, einen katholischen Priester für den Staat zu verpflichten, doch ist es hierzu nie gekommen. Da weniger als zehn Prozent der DDR-Bevölkerung katholisch waren, konnte dies aus staatlicher Sicht auch vernachlässigt werden, die konfessionelle Mehrheit war evangelisch.
Ein weiterer Schritt, die Zügel für die Gefängnisseelsorge enger zu ziehen, war die Festlegung einer klaren Dienstordnung. Diese sollte zwischen der Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei (HVDVP) und der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland ausgehandelt werden, jedoch begegneten sich hier die Beteiligten nicht wie zwei gleichrangige Verhandlungspartner auf Augenhöhe. Am 3. Juli 1953 unterzeichneten Oberkirchenrat Erich Grauheding für die Evangelische Kirche und Generalinspekteur August Mayer, stellv. Leiter der HVDVP, eine von der Volkspolizei vorgelegte Dienstordnung, die den Bewegungsspielraum der nebenamtlichen Gefängnisseelsorger auf ein Minimum begrenzte: So wurde künftig für die Geistlichen eine staatliche Bestätigung notwendig. Missliebige Pfarrpersonenkonnte die Volkspolizei so von den Gefängnissen fernhalten. Im alltäglichen Umgang mit den Gefangenen wurde den Seelsorgern untersagt, Mitteilungen der Inhaftierten weiterzugeben (z.B. an Angehörige) oder auch ihnen Genuss- oder Lebensmittel mitzubringen, was in der Hungerzeit der Nachkriegsjahre durchaus eine grosse Relevanz besass. Gottesdienste durften zwei Mal im Monat stattfinden, „besondere Kulthandlungen, wie z.B. Taufe oder Konfirmation“ benötigten aber die Erlaubnis der Volkspolizei. Den grössten Einschnitt brachten die „Sprechstunden“ mit sich. Seelsorgliche Gespräche waren nur im Beisein eines VP-Beamten gestattet und durften nur zu persönlichen und religiösen Anliegen erfolgen. Vertrauensvolle Gespräche unter vier Augen waren nur den staatlich angestellten Gefängnisseelsorgern gestattet. Die Evangelische Kirche betrachtete diese Regelung als vorläufig und hoffte auf weitere Verhandlungen – zu solchen Zugeständnissen war der Staat jedoch nicht bereit.
Knapp ein halbes Jahr später sagte die HVDVP dem Nachfolger Wienkens im Commissariat der Fuldaer Bischofskonferenz, dem Prälaten Johannes Zinke, zu, „die für die evangelische Seelsorge in den Strafvollzugsanstalten verfügte Dienstordnung entsprechend auch für die Tätigkeit der katholischen Geistlichen in Kraft zu setzen“ . Zinke hoffte, so zumindest eine staatliche Garantie für zwei Messen im Monat in den Vollzugsanstalten sicher zu haben. In den Jugendstrafanstalten und den Untersuchungshaftanstalten war eine seelsorgliche Tätigkeit und das Abhalten von Gottesdiensten von vornherein nicht erlaubt. Die Praxis sollte zeigen, dass es eine solche Garantie nicht gab. So war in den 1950er Jahren nur in einem Teil der Gefängnisse ein 14-tägiger Gottesdienst möglich, in einigen einmal im Monat oder sogar nur quartalsweise und in einigen Gefängnissen gab es sogar überhaupt kein Hineinkommen für die Gefängnisseelsorger. Wenn die Messen überhaupt gestattet wurden, versuchten die Gefängnisleitungen dem grossen Interesse der Insassen entgegenzuwirken, „indem sie beispielsweise zeitgleich die Freistunde durchführten oder Filme zeigten. Teilweise durften auch nur die Häftlinge teilnehmen, die sich schon bei ihrer Aufnahme in die Haftanstalt zu einer der beiden Konfessionen bekannt hatten. Und die Räume, in denen Gottesdienste abgehalten wurden, blieben im Winter ungeheizt.“
Religiöse Literatur und eine katholische Weihnachtsschrift
Da die Dienstordnung die Herausgabe von religiöser Literatur ausschliesslich über die Anstaltsbibliotheken erlaubte, führte Prälat Zinke in den 1950er Jahren wiederholt Verhandlungen mit der HVDVP über die Zulassung katholischer Kirchenzeitungen. Pfarrer Mund, der zwischen seinem Dienstherrn, der Volkspolizei, und den kirchlichen Akteuren vermittelte, machte gegenüber Zinke jedoch deutlich, dass er derartige Bemühungen „für die nächste Zeit für aussichtslos“ hielt. Dringlicher waren zur Mitfeier der Gottesdienste die Schott-Messbücher, die die deutschen Übersetzungen zu den lateinischen Gebetstexten enthielten, sowie Gesangbücher zum Mitsingen. Nur nach und nach gelangten kleine Auflagen in die Gefängnisse. Erst 1953 war die Gesamtanzahl von 2.000 Exemplaren des „Volks-Schott“ in den Anstalten vorhanden. Bei den Gesangbüchern waren im Januar 1956 sogar erst insgesamt 1.515 Exemplare über die HVDVP verschickt worden, so dass einige Anstalten noch länger darauf warten mussten. Teilweise waren diese Liederbücher sogar bis zum Ende der DDR im Einsatz, obwohl seit1975 im deutschen Sprachraum mit dem „Gotteslob“ ein neues Gebet- und Gesangbuch eingeführt worden war.
Die kirchlichen Bemühungen umfassten nicht nur die Zulassung liturgischer Bücher, sondern auch eine Erlaubnis für das Neue Testament sowie für erbauliche Schriften. So gelangten sporadisch die „Nachfolge Christi“ von Thomas von Kempen oder auch „Der Herr“ von Romano Guardini in die Strafvollzugseinrichtungen. Gegenüber der Konferenz der katholischen Gefängnisseelsorger konnte Prälat Zinke zwar erfolgreich vermelden, dass das Neue Testament den Anstalten zugeleitet worden war, gleichzeitig musste er jedoch erhebliche Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der religiösen Literatur zur Kenntnis nehmen. Er gestattete es daher den Seelsorgern, „im Ausnahmefall“ in „Ermangelung katholischer Schriften“ auch die der Evangelischen Kirche zu verwenden und soweit es „akzeptabel ist“, auf das Schrifttum des Union-Verlages zurückzugreifen – dem parteieigenen Verlag der Blockpartei CDU.
Die Bereitstellung religiöser Bücher erfolgte durch den Deutschen Caritasverband. In den 1970er und 1980er Jahren übernahm dieser dann auch die Verhandlungen mit den staatlichen Stellen. Als sich zu Jahresbeginn 1972 die katholischen Gefängnisseelsorger zu einer Konferenz trafen, schilderten sie ein äusserst ernüchterndes Bild vom Bestand an religiöser Literatur und stellten daraufhin eine Liste mit fünf Titeln zusammen und hofften auf eine Genehmigung durch die inzwischen innerhalb der HVDVP gebildete Verwaltung Strafvollzug (VSV). Tatsächlich durfte der Caritasverband zwei Jahre später die gewünschten Bücher zum Einstellen in die Anstaltsbibliotheken der VSV zusenden sowie sechs weitere Titel im Jahr 1982. Die genehmigte Menge von „je 30 Exemplaren“, die in Päckchen verpackt werden sollten, „in denen sich von jedem Titel je ein Exemplar“ befand, war jedoch deutlich kleiner als die Anzahl der Strafvollzugsanstalten in der DDR. Ein letztes Mal durften 1984 fünf Bücher zu „je 20-30 Exemplaren zur Verfügung gestellt“ werden.
Die etwas entgegenkommendere Haltung gegenüber den Kirchen steht in einem zeitlichen Kontext mit dem KSZE-Prozess („Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“) in den 1970er Jahren, in dem die DDR nach aussenpolitischer Beachtung suchte und ein scharfer Kurs gegenüber den Religionsgemeinschaften die Gefahr einer schlechten internationalen Presse nach sich zog. Darüber hinaus wurde 1977 ein neues Strafvollzugsgesetz in Kraft gesetzt und im März 1978 kam es zu einem Spitzentreffen der evangelischen Kirchenleitung mit Staats- und Parteichef Erich Honecker. In dessen Nachgang wurde bei den staatlichen Stellen auch die Frage der religiösen Literatur thematisiert. Und so kam es, dass Helmut Serfas, Oberstleutnant in der Abteilung Vollzugsgestaltung der VSV, am 12. September 1983 an Günther Behnke, Abteilungsleiter beim Staatssekretär für Kirchenfragen, die Entscheidung übermittelte, dass es den Strafgefangenen nun gestattet sei, „alle in der DDR lizensierten Zeitungen zu beziehen, darunter auch die kirchlichen.“ Damit wurde zumindest theoretisch, 31 Jahre nachdem Prälat Zinke das Anliegen der Volkspolizei vorgetragen hatte, der Bezug von Kirchenzeitungen möglich.
Weil die Versorgungsmöglichkeiten mit religiösem Lesestoff äusserst gering waren, entwickelte Zinke bereits im Dezember 1952 die Idee, „den Inhaftierten im Gebiete der DDR“, eine „kleine Weihnachtsschrift“ zukommen zu lassen. Er wandte sich diesbezüglich an Josef Gülden, Chefredakteur der Kirchenzeitung „Tag des Herrn“, der ab 1953 ein 4-Seitiges Heft verlegte. Es trug den Titel: „Die gute Botschaft zum Weihnachtsfest“. Dabei wurde insbesondere in den Anfangsjahren penibel darauf geachtet, ausschliesslich Texte und Bilder zu verwenden, die bereits in dem Kirchenblatt bzw. in anderen Publikationen des kircheneigenen St. Benno-Verlags veröffentlicht worden waren. Es handelte sich somit um Inhalte, „die in der DDR bereits einmal genehmigt“ wurden. Gülden hoffte dadurch, mögliche Probleme bei der Zensur umgehen zu können. Die Schwierigkeiten wurden zunächst an der Frage der Auflagenhöhe deutlich. Zinke bat 1953 die HVDVP, eine Auflage von 5.000 Exemplaren zu erlauben. Es wurden jedoch nur 2.000 Stück genehmigt und das obwohl in den 1950er Jahren die Gefängnisse meist überbelegt waren und ein deutlich höherer Bedarf vorhanden gewesen sein musste. In den Folgejahren entfaltete sich ein Machtspiel, in dem ohne Begründung mehrmals sogar nur 1.000 Exemplare statt der dann beantragten 2.000 Stück erlaubt wurden. Erst ab 1963 musste um die Auflage nicht mehr gerungen werden.
Obwohl im Zeitraum von 1953 bis 1968 die Redaktion nur bereits in der DDR erschienene Beiträge für den Druck der Weihnachtsbotschaft vorsah, gab es dennoch mehrere staatliche Zensurmassnahmen: So durfte beispielsweise 1958 eine Zeile eines Gebetstextes, „O ewige Freiheit, wie bist Du gefangen“, nicht erscheinen oder bei einem Weihnachtslied der Hinweis, dass es aus Schlesien stammte. Ab 1969 wurde „die gute Botschaft zum Weihnachtsfest“ sukzessiv aufgewertet. Den Verantwortlichen war dabei bewusst, dass die katholische Kirche nur geringe Möglichkeiten besass, seelsorglich in den Haftanstalten wirksam zu werden: Einzelgespräche waren nicht möglich, Gottesdienste nur in einem überschaubaren Massstab und das seelsorgliche Mittel der religiösen Literatur stand ebenso nur in einem eingeschränkten Umfang zur Verfügung. Ein Lichtblick schien hier der kirchliche Weihnachtsgruss zu sein, der – wenn auch nur mit vier Seiten – seit 1953 kontinuierlich in die Gefängnisse gebracht werden konnte. Diesen wollte man nun offensichtlich bestmöglich gestalten. So wurde ab 1969 hochwertiges Bilderdruckpapier verwendet, wie man es sonst hauptsächlich von Kunst- und Bildbänden kannte, so dass das Weihnachtsblatt „im Sonderdruck“ hergestellt werden konnte. Zudem verfassten ab 1969 katholische Gefängnisseelsorger auch eigene Artikel und ab 1972 sollte mit einer Weihnachtspredigt auf der ersten Seite „immer einem Bischof das erste Wort gehören.“ Die DDR-Bischöfe wechselten sich hierbei jedes Jahr ab und signalisierten damit auch ihre Verbundenheit und Hirtensorge um die Gefangenen.

Die sächsische Anstaltskirche der Justizvollzugsanstalt Bautzen.
Die Gefängnisseelsorge in den 1970er und 1980er Jahren
Zu Beginn der 1970er Jahre bestand das grösste Problem für die katholische Kirche „in der Zulassung neuer Seelsorger“ Die zugelassenen Geistlichen waren grösstenteils seit den 1950er Jahren im Einsatz und erreichten nun das Pensionsalter. Der Versuch von Caritasdirektor Theodor Hubrich, dies beim Ostberliner Innenministerium ansprechen zu können, scheiterte jedoch. Die Verwaltung Strafvollzug lehnte jeden Kontakt mit Vertretern der evangelischen oder katholischen Kirche ab. Stattdessen sollten sie sich an die 1957 gegründete Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen wenden. Damit besassen die Kirchen keine Möglichkeit, zu den im MdI getroffenen Entscheidungen Nachfragen stellen zu können. Der katholische Gefängnisseelsorger Helmut Neumann, der sich insbesondere in der Konferenz der Anstaltsgeistlichen als auch in der Redaktion der Weihnachtsbotschaft engagierte, richtete an die ostdeutschen Bischöfe eine Bitte, die die Situation zu Beginn der 1970er Jahre treffend zusammenfasst: „Es sollte alles versucht werden, das Erliegen dieser Seelsorge auf dem ‹kalten Wege› zu verhüten.“
Da die Seelsorge nur auf ausdrücklichen Wunsch des Gefangenen erfolgen durfte, viele von dieser Möglichkeit aber überhaupt nichts wussten, schlugen Neumann und Caritasdirektor Roland Steinke den Bischöfen vor, dass die Heimatpfarrer die Angehörigen hierüber aufklären sollten. Zudem sollten sie inhaftierte Gemeindemitglieder dem Ordinariat für die Gefängnisseelsorger melden. Eine zentrale Meldung lehnten die Bischöfe jedoch ab, da sie befürchteten, dass dies „gesetzlich nicht möglich“ sei. Allerdings erklärten sie sich bereit, „die Pfarrer über die Dekanenkonferenzen darüber zu informieren, dass für Inhaftierte ein gesetzlicher Anspruch auf religiöse Betreuung“ bestünde.
Am 13. Juli 1976, während eines Routinetermins in der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen, kam Ordinariatsrat Gerhard Lange von sich aus auf die Gefängnisseelsorge zu sprechen, ohne dass dieses Thema zuvor vereinbart worden war. Lange, der seit 1974 von den Bischöfen für Gespräche mit staatlichen Stellen beauftragt war, gab einen Überblick über die – wie er es nannte – „derzeitige trostlose Situation.“ Demnach gab es „3 Gruppen von Haftanstalten“: (1) Solche in die katholische Seelsorger nicht hinein kamen, (2) solche in denen Seelsorger „wohl akzeptiert“ wären, aber vom jeweiligen Anstaltsleiter zurückgewiesen wurden, da angeblich „kein Bedürfnis nach Seelsorge vorhanden“ wäre und (3) die Gefängnisse, in denen einmal im Monat Gottesdienst möglich war. Dies sei „der Fall in Brandenburg, Nau[m]burg, Torgau und Cottbus“. Seine Gesprächspartnerin, die Abteilungsleiterin für Rechts- und Grundsatzfragen, Elfriede Schumann-Fitzner, ging darauf nicht näher ein, erläuterte aber zumindest die Verfahrensweise für die Neuzulassung von katholischen Seelsorgern, die über die regionalen Dienststellen für Kirchenfragen beantragt werden müssten. Allerdings legte sie Lange nahe, dass nur „solche Pfarrer als Gefängnisseelsorger“ vorgeschlagen werden sollten, „die Vertretern der staatlichen Organe gegenüber gesprächsbereit“ wären.
Ende 1977 waren 13 katholische Priester in der gesamten DDR nebenamtlich als Gefängnisseelsorger zugelassen, auf evangelischer Seite waren es sogar nur 7 Geistliche, da dort noch der beim MdI eingestellte Pfarrer Giebeler zum Einsatz kam. Am 6. März 1978 fand das Spitzengespräch zwischen Erich Honecker und der evangelischen Kirchenleitung statt, bei der das Thema Gefängnisseelsorge mit angeschnitten wurde. Im Nachgang dazu kam etwas Bewegung in die Angelegenheit, denn Honecker hatte bei der Begegnung behauptet, dass die religiöse Betreuung in den Haftanstalten gewährleistet sei, worauf sich die Kirchen nun berufen konnten. Die evangelische Kirche konnte noch im selben Jahr elf Geistliche als Gefängnisseelsorger benennen und auch die Seelsorge in Haftkrankenhäusern und Jugendstrafanstalten wurde nun offiziell gestattet, wobei aber Gottesdienste in den Jugendhäusern verboten blieben.
Ab 1980 waren 18 katholische Priester für den Dienst in den Strafvollzugsanstalten staatlich zugelassen, da jedes Bistum bzw. Bischöfliche Amt für ihr Gebiet noch einen Stellvertreter benennen durfte, der im Krankheitsfall die Vertretung übernehmen würde. In der Praxis änderte sich jedoch nicht viel. Nach wie vor fanden nur in einem Teil der vorhandenen Strafvollzugsanstalten monatliche Gottesdienste statt, deren Teilnehmerzahlen eher gering waren, da der Besuch hierfür extra beantragt werden musste. In der Mehrzahl der Einrichtungen – vor allem den kleineren Haftanstalten – wünschte angeblich keine einzige inhaftierte Person eine religiöse Betreuung, wie die Gefängnisverwaltung behauptete. Oft wurde den Gefangenen aber auch gar nicht mitgeteilt, dass Gottesdienste jetzt theoretisch möglich waren. Zudem hätten an einem Gottesdienst vermutlich mehr Häftlinge teilgenommen, hätten sie dadurch nicht Nachteile oder gar Schikanen durch die Aufseher riskiert. „So war die Teilnahme am Gottesdienst bis zuletzt eine gnädiger Weise gewährte Vergünstigung und kein verbrieftes Recht.“
 In den Jugendstrafeinrichtungen fanden keine Gottesdienste statt, ganz selten wurde auf Verlangen ein seelsorgliches Gespräch durchgeführt. Problematisch wurde es, wenn durch Versetzung oder Tod die Stelle eines Gefängnisseelsorgers vakant wurde. Die staatlichen Behörden liessen sich dann mehrere Monate, mitunter sogar Jahre für eine Neuzulassung Zeit – solange aber gab es dann auch in der Anstalt keine Messe.
In den Jugendstrafeinrichtungen fanden keine Gottesdienste statt, ganz selten wurde auf Verlangen ein seelsorgliches Gespräch durchgeführt. Problematisch wurde es, wenn durch Versetzung oder Tod die Stelle eines Gefängnisseelsorgers vakant wurde. Die staatlichen Behörden liessen sich dann mehrere Monate, mitunter sogar Jahre für eine Neuzulassung Zeit – solange aber gab es dann auch in der Anstalt keine Messe.
Dr. Martin Fischer , Theologische Fakultät der Universität Erfurt | Aus: Seelsorge & Strafvollzug.ch, Nr. 5/2021
Dr. Martin Fischer, 1980, ist katholischer Theologe und Kirchenhistoriker. Er ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte an der Universität Erfurt tätig. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Geschichte der katholischen Kirche in der DDR, ihr pastorales Handeln sowie ihre Rolle bei der Friedlichen Revolution. Zur Geschichte der katholischen Gefängnisseelsorge in der DDR erscheint 2021 von ihm eine Monografie in der Reihe „Erfurter Theologische Schriften“ (Echter-Verlag Würzburg).