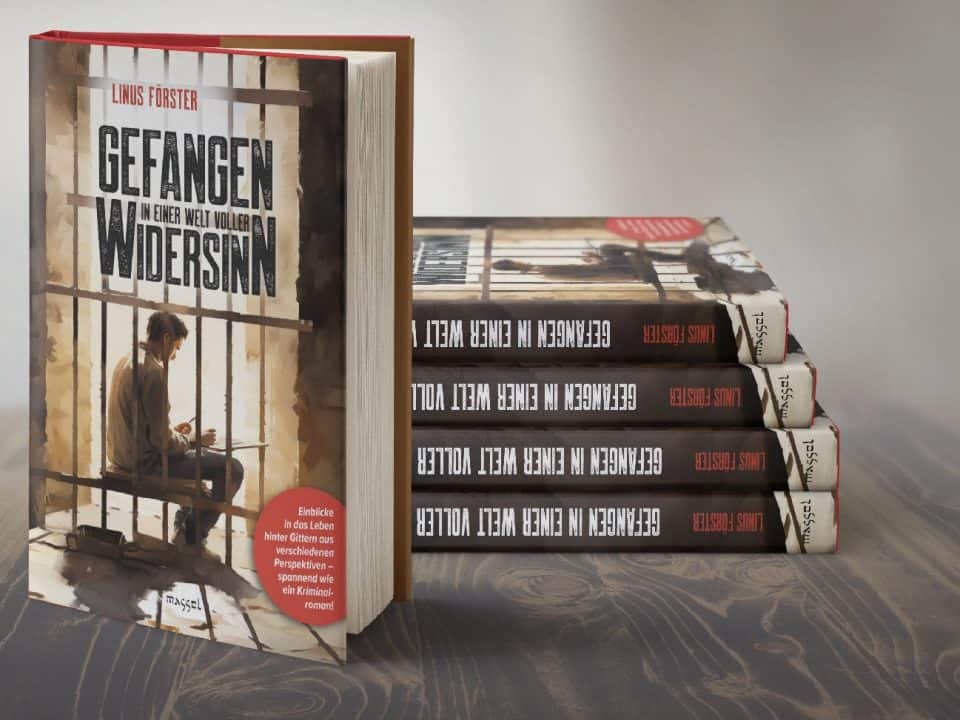Nordrhein-Westfalen ist das einzige Bundesland, das über einen Justizvollzugsbeauftragten verfügt. Diese Stelle wird seit vielen Jahren von Prof. Dr. Michael Kubink besetzt. Jetzt hat er und sein Team einen Kurzbericht verfasst, in dem er einerseits über seine Tätigkeiten berichtet und andererseits Vorschläge zur Verbesserung des Justizvollzugs unterbreitet.
Gegenstand des Kurzberichtes ist eine Auflistung der über 200 Eingaben im Jahr 2024, die Darstellung von Gesprächen, Veranstaltungen und Anstaltsbesuchen sowie die konzeptionellen Tätigkeiten. Der größte Teil der Eingaben der Gefangenen bezog sich abermals auf die Gesundheitsversorgung in den Anstalten. Die langfristige Dominanz dieses Themas verdeutlicht zum einen die wachsenden Herausforderungen an das Vollzugssystem, das seine Handlungsmöglichkeiten auf diesem Gebiet ausbauen muss. Zum anderen zeigt es aber zugleich, dass die Klientel der Inhaftierten augenscheinlich unter tendenziell zunehmenden physischen und psychischen Problemen zu leiden scheint. Angebotsprobleme (z.B. im Hinblick auf die schwierige Akquise von ärztlichem Personal) und eine erhöhte Nachfrage (durch Drogenabhängige und/oder psychisch auffällige Gefangene) beeinträchtigen den Justizvollzug nachhaltig und landen nicht selten als Hilfsbegehren beim Justizvollzugsbeauftragten.
Eingaben aus der Gefängnisseelsorge
Als „Dauerbrenner“ wird das gesetzlich definierte Briefgeheimnis im Schriftwechsel mit dem Justizvollzugsbeauftragten immer noch in nicht seltenen Fällen verletzt wird. Ferner äußerten einzelne Gefangene in ihren Eingaben die Befürchtung, dass die Kontaktaufnahme zum Justizvollzugsbeauftragten ihnen zum Nachteil gereichen würde. Nach wie vor wird das Aufkommen der Eingaben von den Anliegen der Inhaftierten aus dem geschlossenen Vollzug bestimmt. Jedoch ist im Vorjahresvergleich ein Rückgang von 20 % zu verzeichnen. Die Eingaben des offenen Vollzuges wiederum haben eine Steigerung von 50 % erfahren, wenngleich das recht geringe Ausgangsniveau die Steigerungsrate relativiert. Auch haben sich Angehörige vermehrt – wenn auch weiterhin insgesamt selten – an den Justizvollzugsbeauftragten gewandt. Die Anzahl von Bediensteten des Justizvollzuges, die in eigener Sache Eingaben an den Justizvollzugsbeauftragten gerichtet haben, hat sich mehr als verdoppelt. Auch hier ist aber die geringe Absolutzahl zu beachten. Vermehrt gingen überdies Eingaben aus der Seelsorge ein, die sich für Gefangene eingesetzt haben.
Themen
- Braucht der Vollzug einen Medienbeauftragten, insbesondere für die Netzauftritte der JVAs und die Vermittlung von fachlichem Wissen aus dem Vollzug in den neuen sozialen Medien?
- Umgang mit psychisch kranken Inhaftierten: Das Konzept der „psychiatrisch-intensivierten Behandlung“ soll eine Verbesserung bringen. Es wird jedoch nicht evaluiert. Im Justizvollzugskrankenhaus gibt es mittlerweile 53 Plätze für die Akutpsychiatrie (bei einem Bedarf von 80 Plätzen). Der Ausbau der Kapazität geht zu Lasten einer Pflegestation. Für diese besteht jedoch ebenfalls ein Bedarf, da die Insassen immer älter werden.
- Sterben im Vollzug? Die Bedarfsanalyse geht von 20 bis 35 Sterbefällen pro Jahr aus. Künftig sollen drei Haftplätze für die Palliativmedizin eingerichtet werden.
- Die Mutter-Kind-Einrichtung mit 16 Plätzen ist nur zum Teil belegt, da die Zugangsmöglichkeiten sehr restriktiv sind. Gerade die kurzen Freiheitsstrafen könnten hier besser berücksichtigt werden.
- Der Übergang vom geschlossenen in den offenen Vollzug (Progression) scheitert teilweise an überzogen „anmutenden Anforderungen an gutachterliche Stellungnahmen, die Entlassungsentscheidungen ähneln“. Der offene Vollzug sollte viel stärker genutzt werden, gemäß der Merkformel: „Entlassung regelmäßig über den offenen Vollzug.” Er stellt fest: „Während der anfängliche offene Vollzug die Notwendigkeit einer als stationäre Sanktion verhängten Freiheitsstrafe insgesamt in Frage stellt, geht es im Kontext der Progression um das Selbstbewusstsein des Behandlungsvollzuges, seinen eigenen Maßnahmen nachhaltige Wirkung zuzutrauen.“

Arbeit
Das Bundesverfassungsgericht hat alle Beteiligten in vollzugsorganisatorischer Verantwortung vor die anspruchsvolle Aufgabe gestellt, Arbeit im Justizvollzug zum integralen Bestandteil des Behandlungsvollzuges zu entwickeln, ohne sich dabei allein auf selbstgefällige Annahmen und Behauptungen von Zweckmäßigkeiten zu berufen. Hier geht es um komplexe Fragen, welche die Konzeption und auch die Struktur des justiziellen Behandlungsvollzuges grundlegend betreffen. Auf Seiten der Nachfrager geht es um die Individualisierung von Arbeit als Behandlungsmaßnahme, die sicher nicht mit der allzu oft leichter Hand formulierten Kritik an den Inhaftierter, es mangele mehr und mehr an deren Arbeitskompetenzen, abgetan werden kann. Zugleich muss der Blick für künftige Gestaltungen auch der Angebotsseite gelten – gerade, wenn man die These des Kompetenzschwundes ernst nimmt.
Strukturell interessiert aber ebenso, wie das System auf den Umstand reagiert, dass immer mehr Unternehmerbetriebe ihre Kooperation mit den Anstalten (vorgeblich) aufgrund nicht wettbewerbsfähiger Betriebskosten aufkündigen; ein Umstand, der angesichts der gestiegenen Vergütung der Inhaftierten noch zunehmende Bedeutung erlangen wird. Gemäß den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts muss es auf Landesebene insbesondere gelingen, dass Arbeit künftig als wirksame Behandlungsmaßnahme implementiert wird. Insoweit hat der Justizvollzugsbeauftragte eine kritische Stellungnahme zum Gesetzentwurf abgegeben.
Jugendvollzug
Der Jugendvollzug braucht etwas frischen Wind, er schöpft seine Potenziale noch nicht aus. Im Jugendstrafrecht wird das Sanktionssystem des JGG üblicherweise als Vorbild erachtet, das dem Strafgesetzbuch an Vielfalt und Gestaltungsspielräumen deutlich voraus ist. Im vollzuglichen Bereich ist von dieser „Vorreiterfunktion“ wenig zu erkennen. Ein moderner Jugendvollzug sollte von einer intensiven persönlichen Betreuung und von verschiedenen Lockerungsmöglichkeiten geprägt sein, die den jungen Inhaftierten die Abkehr von ihren bisherigen Lebenswelten und die – besser sozialisierte – Rückkehr dorthin deutlich erleichtern. Gerade der Jugendvollzug braucht mehr Öffnungsperspektiven und ein spezialisiertes Übergangsmanagement, das z.B. auch deutlicher auf Inhaftierte mit Migrationshintergrund ausgerichtet ist. Ein Weg in die richtige Richtung sind Erweiterungen der intensivierten und in Wohngruppen vollzogenen Betreuung nach dem Modell der JVA Heinsberg, die von der Aufsichtsbehörde geplant sind. Dieses Design sollte künftig zum Mindeststandard im Bereich des Jugendvollzuges erklärt werden. Darüber hinaus sind aber weitere Wege zu gehen, um den Jugendstrafvollzug in NRW zukunftstauglich zu machen.